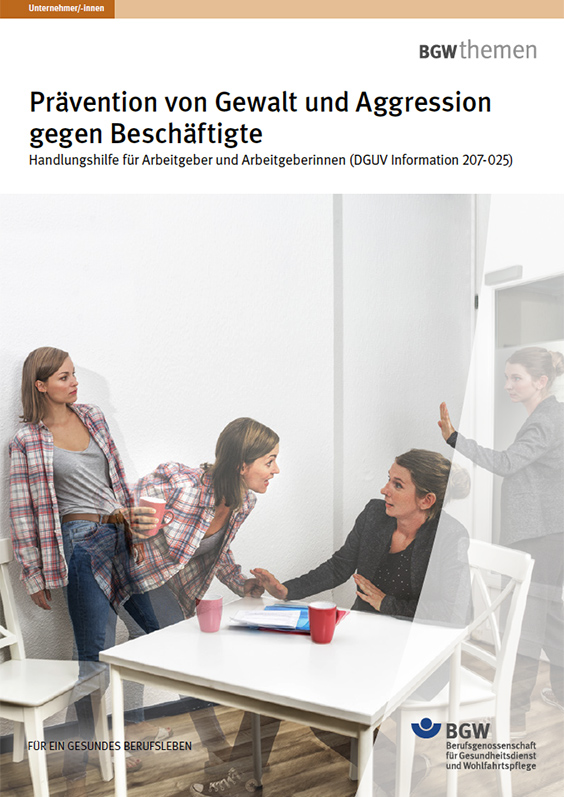Mit Schutzkonzepten gegen Gewalt und Belästigung angehen BGW magazin 1/2026
Gewalt hat viele Gesichter – so titelte das BGW magazin schon vor zehn Jahren. Leider hat das Thema nichts von seiner Aktualität verloren. Im Gegenteil: Betriebliche Schutzkonzepte erscheinen nötiger denn je, um Mitarbeitende vor sexualisierter Belästigung, verbaler und körperlicher Gewalt und deren Folgen zu bewahren. Was macht ein praxistaugliches Konzept aus?
Lesen Sie in diesem Artikel:
- Schutz als institutionelle Daueraufgabe
- Zunehmende Gewalt als Herausforderung für Einrichtungen und für die Gesellschaft
- Standards vorgeben, Mitarbeitende ins Boot holen
- Schutzkonzepte gibt es nicht als Kopiervorlage
- Haltung und Handlung – und Engagement der Führungskräfte
- Erfolgsfaktoren für betriebliche Schutzkonzepte
- Aus der Praxis: Beratung durch die Aufsichtspersonen der BGW
- Ist das schon Belästigung?
- Sexualisierte Belästigung stets mitberücksichtigen
Niemand soll während der Arbeit oder der Ausübung eines Ehrenamtes Gewalt erfahren
. Bei der Eröffnung des siebten Symposiums „Gewalt, Aggression und Belästigung am Arbeitsplatz“ griff die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der BGW, Claudia Drechsel-Schlund, eine Resolution der Mitgliederversammlung des Spitzenverbands Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) auf. Sie machte deutlich, dass der Schutzanspruch überall gilt – auch dort, wo Menschen behandelt, gepflegt, begleitet oder beraten werden, die unter Umständen aus gesundheitlichen Gründen herausforderndes Verhalten zeigen.
Beim Symposium am 6. und 7. November diskutierten fast 1.000 Teilnehmende online und etwa 200 vor Ort, wie Gewaltschutz praktikabel umgesetzt werden kann. Die Veranstaltung unterstützte auch die aktuelle DGUV-Kampagne #GewaltAngehen – Gemeinsam stark gegen Gewalt.
Schutz als institutionelle Daueraufgabe
Auf großen Anklang stieß das Plädoyer von Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie Deutschland, für eine klare Haltung – gegen sexualisierte Belästigung, gegen Gewalt und gegen Machtmissbrauch: Es geht darum, für ein respektvolles Miteinander Sorge zu tragen und für die Integrität und den Schutz aller vor struktureller und personaler Gewalt.
Schuch stellte den Ansatz der Diakonie vor, für die rund 687.000 Mitarbeitende und 700.000 ehrenamtlich Engagierte in einem föderal organisierten Verband tätig sind. Er betonte, dass es Regelungen mit einem möglichst hohen Maß an Verbindlichkeit bedürfe. So verpflichte nun eine Rahmenbestimmung zum Schutz vor und zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt alle Mitgliedseinrichtungen zur Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung eines eigenen Schutzkonzepts: Sie ist Ausdruck eines Kulturwandels. Sie verbindet die Haltung der Fürsorge mit dem Prinzip der Kontrolle. Sie macht deutlich, dass Schutz kein individuelles Engagement Einzelner ist, sondern eine institutionelle Daueraufgabe.
Zunehmende Gewalt als Herausforderung für Einrichtungen und für die Gesellschaft
Schuch ging auch auf die Zunahme an rechtsextremistisch motivierter Gewalt und Belästigung ein. In der täglichen Arbeit vor Ort würden Mitarbeitende der Diakonie Anfeindungen und Bedrohungen, Beleidigungen und Einschüchterung erfahren. Es liegt in unserer Verantwortung als Arbeitgeber, Gefährdungen vorzubeugen und Beschäftigte im Umgang mit rechter Gewalt und bei der Verarbeitung des Erlebten zu unterstützen.
Große Sorgen bereite ihm auch ein gesellschaftliches Klima, das zunehmend polarisiert sei. Deshalb komme es aufs Hinschauen, aufs Helfen, aufs Handeln an – und auf eine glasklare Absage an psychische und physische Gewalt, an Diskriminierung und Abwertung von Menschen.
Gewalt und Belästigung in Zahlen
- Über 50 Prozent der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen haben innerhalb von 12 Monaten bei der Arbeit verbale Übergriffe erlebt.
- Rund 22 Prozent haben körperliche Gewalt erfahren.
(Ergebnisse einer branchenweiten Umfrage im Auftrag der DGUV, 2024)
Standards vorgeben, Mitarbeitende ins Boot holen
Von einer hohen Zahl an Gewaltvorfällen berichtete auch Prof. Dr. Paul Alfred Grützner, Geschäftsführer Medizin der BG Kliniken – des Klinikverbunds der gesetzlichen Unfallversicherung mit insgesamt neun Kliniken und mehr als 19.000 Beschäftigten – und Ärztlicher Direktor der BG Klinik Ludwigshafen. Er stellte gemeinsam mit BGW-Präventionsleiterin Hanka Jarisch das Gewaltpräventionskonzept „Sicherheit für alle“ der BG Kliniken vor. Dort wird der Gewaltschutz als Top-Managementthema verstanden – und die Geschäftsführung bezieht klar Haltung. Das Konzept wende sich an alle Mitarbeitenden, Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher, so Grützner. Zum einen enthalte es Standards, die alle Standorte des Konzerns erfüllen müssten, angepasst an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort – zum Beispiel Sicherheitssysteme an Zugangstüren und Deeskalationstrainings. Darüber hinaus gebe es Maßnahmen mit Empfehlungscharakter, die individuell geprüft und ergänzt werden könnten – zum Beispiel ein Ampelsystem, das in der Notaufnahme über Wartezeiten informiert. Die Leute können warten, wenn sie eine Perspektive haben
, so Grützner.
Neue Mitarbeitende würden bereits am ersten Arbeitstag im Rahmen des Onboardings und in den Arbeitssicherheitsschulungen über die konkreten Maßnahmen zur Gewaltprävention informiert. Ein Handlungsleitfaden mache für alle jederzeit klar, um was es gehe und was zu tun sei – und hänge überall gut sichtbar aus. Ebenso gehörten Deeskalationstrainings fest zum internen Fortbildungsprogramm.
Schutzkonzepte gibt es nicht als Kopiervorlage
Claudia Drechsel-Schlund verwies darauf, dass Gewaltschutzkonzepte nicht zu kurz greifen dürften: Sie müssen vom Vorbeugen über das Agieren im Akutfall bis hin zur Nachsorge für die Betroffenen reichen. Und sie müssen die konkrete Situation in der Einrichtung berücksichtigen.
Wie Schutzkonzepte für große und kleine Einrichtungen, Verbände ebenso wie Einzelbetriebe maßgeschneidert werden können, zeigten verschiedene Vorträge und Workshops. Das Beispiel eines Kita-Trägers aus Berlin verdeutlichte unter anderem, dass Gewalt und Belästigung auch von Kindern und Eltern ausgehen können – und wie sich mithilfe der BGW-Organisationsberatung differenziert vorgehen lässt. Die umfangreichen BGW-Unterstützungsangebote sowohl für Unternehmen als auch für Betroffene von Gewaltvorfällen wurden vorgestellt.
Immer wieder kamen die verschiedenen Bausteine von Gewaltschutzkonzepten zur Sprache (siehe Übersicht unten). Der Wunsch vieler Unternehmen nach einer „Kopiervorlage“ für das eigene Gewaltschutzkonzept lässt sich allerdings nicht erfüllen. Die Programmleiterin des Gewaltsymposiums, BGW-Referentin für Changemanagement und systemische Beraterin Kajsa Johansson, erläuterte darüber hinaus: Ein funktionierender Gewaltschutz lebt davon, dass er auf die individuellen Rahmenbedingungen eingeht. Das bedeutet, die Menschen einzubeziehen, die es betrifft.
Haltung und Handlung – und Engagement der Führungskräfte
Bewährte Instrumente des Arbeitsschutzes wie die Gefährdungsbeurteilung könnten dafür genutzt werden, konkrete Gefährdungen zu erkennen und geeignete Maßnahmen umzusetzen. Johansson pflichtete zudem Prof. Dr. Paul Alfred Grützner von den BG Kliniken bei: Es kommt auf Haltung und Handlung gleichermaßen an. Schutzkonzepte dürfen keine Lippenbekenntnisse bleiben.
Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch hob, wie viele weitere Rednerinnen und Redner, darüber hinaus die besondere Rolle der Führungskräfte hervor. Ihr Verhalten, ihre Haltung, ihre Machtsensibilität seien entscheidend für die Wirksamkeit von Gewaltschutzkonzepten. Letztlich seien sie dafür verantwortlich, dass sich Menschen in ihrem Verantwortungsbereich sicher fühlten.
BGW-Präventionsleiterin Hanka Jarisch sah insbesondere auch die Unternehmensleitungen gefordert: Es ist wichtig, dass sich die Leitung des Themas annimmt – es ist Teil ihrer Fürsorgepflicht. Außerdem würde man sonst die einzelnen Beschäftigten mit der Unsicherheit belasten, Entscheidungen selbst treffen zu müssen. Gehen Sie alle gemeinsam gegen Gewalt an!
Erfolgsfaktoren für betriebliche Schutzkonzepte
- Ziel definieren: Was soll erreicht werden?
- Verbindlichkeit herstellen
- Haltung und Handlung auf allen Ebenen zeigen, angefangen bei der Leitung und den Führungskräften
- Begriffe und rechtlichen Rahmen klären: Was ist Gewalt und Belästigung?
- Gewaltschutz fest in den betrieblichen Arbeitsschutz einbinden: Gefährdungsbeurteilung, insbesondere auch psychischer Belastung, als Ausgangspunkt
- Alle Phasen in den Blick nehmen:
- Davor: Wie lassen sich Vorfälle verhindern?
- Dabei: Was ist zu tun, wenn etwas passiert?
- Danach: Wie werden Betroffene unterstützt? Welche Anlaufstellen gibt es? Wie werden Vorfälle aufgearbeitet?
- Maßnahmen nach S-T-O-P:
- Substitution: Lässt sich eine Gefährdung vermeiden, indem beispielsweise bestimmte Dienste nicht angeboten oder Personen nicht betreut werden?
- Technisch/baulich: zum Beispiel Zutrittssteuerung, Beleuchtung, Rückzugsräume …
- Organisatorisch: zum Beispiel Notfallplan, Fehlerkultur, Fallbesprechungen und Übergaben, Beurteilung von Alleinarbeit, Absprachen mit der Polizei …
- Personell: zum Beispiel jährliche Unterweisung zum Verhalten im Notfall …
- Individuelle Rahmenbedingungen aufgreifen
- Deeskalation als wichtigen Baustein verankern – zum Beispiel mit regelmäßigen Deeskalationstrainings für Mitarbeitende
- Unterstützungsangebote durch die BGW nutzen, unter anderem:
- Informationsmedien und Handlungshilfen
- Seminare
- Organisationsberatung inhouse (überwiegend kostenfrei)
- Förderung für die Qualifizierung von innerbetrieblichen Deeskalationstrainerinnen und -trainern – die dann Mitarbeitende schulen – sowie für die Qualifizierung von kollegialen Erstbetreuerinnen und Erstbetreuern
- Gewaltvorfälle konsequent dokumentieren und melden
- Individualprävention von Traumafolgen gewährleisten – also dafür sorgen, dass die psychischen Folgen eines Extremereignisses möglichst gering bleiben:
- Soziale Unterstützung sichern
- „Watchful Waiting“: Beobachten, ob sich jemand nach einem Vorfall verändert und zusätzliche Unterstützung nötig ist
- Sicherheitsgefühl wiederherstellen
- Gefährdungsbeurteilung aktualisieren
- Möglichkeiten zur Offenbarung geben
- Besondere Leistungen der BGW für betroffene Versicherte nach Extremerlebnissen bekanntmachen, unter anderem:
- Telefonisch-psychologische Beratung – unkompliziert bis zu fünf Telefontermine nach Meldung bei der zuständigen BGW-Bezirksverwaltung
- Probatorische Sitzungen und Psychotherapie – fünf probatorische Sitzungen sind bereits ohne Prüfung möglich
- Schutzkonzept im Unternehmen sichtbar machen – kommunizieren – leben
- Konzept regelmäßig überprüfen und anpassen – zum Beispiel nach Vorfällen
Aus der Praxis: Beratung durch die Aufsichtspersonen der BGW
Die BGW kann auch in besonderen Einzelfällen unterstützen. Nicole Stab, stellvertretende Leiterin der BGW-Bezirksstelle Dresden schilderte auf dem Gewaltsymposium zwei Beispiele aus ihrer Tätigkeit als Aufsichtsperson: In einer Einrichtung der Eingliederungshilfe kam es wiederholt zu Übergriffen durch einen Klienten. Hier ging es um Alleinarbeit
, erläuterte Stab: Wann ist es nicht mehr vertretbar, dass Mitarbeitende allein tätig sind? Im anderen Beispiel häuften sich Gewaltvorfälle in einer Jugendhilfeeinrichtung. Dort stellte sich unter anderem die Frage, wie Mitarbeitende durch Deeskalationstrainings qualifiziert werden könnten. Beide Einrichtungen standen dabei auch vor finanziellen Herausforderungen. Von der BGW-Aufsichtsperson bekamen sie mit einer offiziellen Anordnung schließlich entscheidende Argumente an die Hand, um nötige Budgets zu verhandeln beziehungsweise eine Kostenübernahme durch den Kostenträger zu erlangen.
Ist das schon Belästigung?
Letztendlich geht es darum, wie die Person, die etwas erlebt, das Ganze wahrnimmt. Wenn es eine gefühlte Grenzüberschreitung ist und eine Verletzung der Würde, dann kann das durchaus sexualisierte Belästigung sein. Und sexualisierte Belästigung hat negative Folgen für die psychische und körperliche Gesundheit. Insofern ist das nicht kleinzureden, sondern sehr ernst zu nehmen.
Dr. Mareike Adler, BGW-Psychologin im BGW-Podcast, Folge 131.
Das Gesundheits- und Sozialwesen ist stärker als andere Branchen von sexualisierter Gewalt und Belästigung bei der Arbeit betroffen.
Innerhalb von zwölf Monaten erlebten Beschäftigte aus Pflege, Kliniken, psychiatrischen Einrichtungen und der Behindertenhilfe
- verbale sexualisierte Gewalt – zum Beispiel anzügliche Komplimente: 63 Prozent
- körperliche Vorfälle: 49 Prozent
- nonverbale Ereignisse – zum Beispiel als Zeuge oder Zeugin von Situationen, in denen es zu sexualisierter Belästigung oder Gewalt kam: 67 Prozent
(Adler et al. 2021, siehe auch: Hintergrundinformationen zu Gewalt und Belästigung)
Sexualisierte Belästigung stets mitberücksichtigen
Bei sexualisierter Belästigung kommen einige zusätzliche rechtliche Grundlagen und praktische Empfehlungen zum Tragen, die in das betriebliche Gewaltschutzkonzept einzubinden sind. Dazu gehört insbesondere:
- Alle Formen sexualisierter Belästigung in der Gefährdungsbeurteilung aufgreifen und Maßnahmen ableiten.
- Für den Akutfall eine Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vorhalten.
- Möglichst auch vertrauliche Anlaufstellen einrichten oder bekanntmachen.
Vertrauliche Beratungsstellen klären über die Einordnung von Vorfällen und Optionen auf
, erläutert BGW-Psychologin Dr. Mareike Adler. Zum Beispiel: Ist das Belästigung? Welche Wege habe ich? Was folgt etwa aus einer Beschwerde bei der AGG-Beschwerdestelle? Das ist insbesondere auch relevant, wenn der verbale oder körperliche Übergriff von Vorgesetzten oder Kolleginnen und Kollegen ausgeht.
Eindrücke vom BGW-Gewaltsymposium 2025