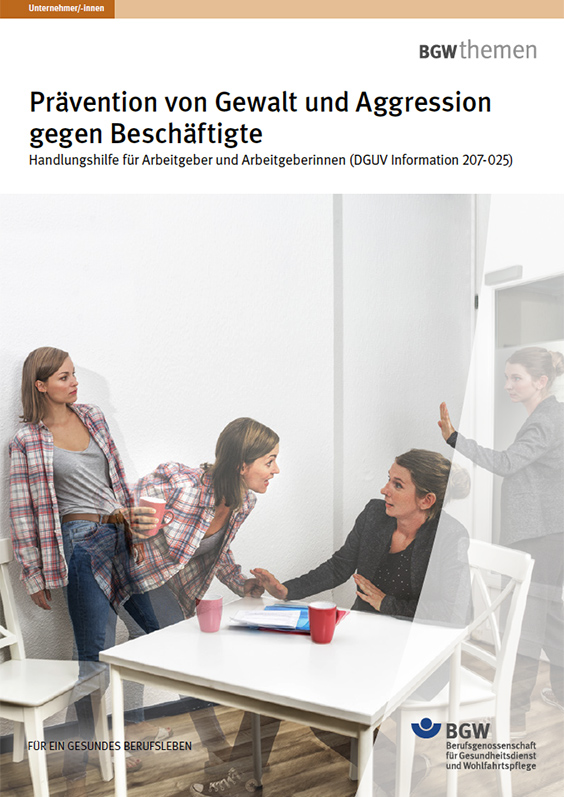Moderator:
Auch im Gesundheitsdienst ereignen sich Konflikt- und Krisensituationen, in deren Verlauf Mitarbeitende physisch oder psychisch verletzt werden. Ja, Aggressivität und Gewalt sind leider Bestandteil menschlicher Ausdrucks- und Verhaltensweisen.
Vor allem die sexualisierte Gewalt gegen das Pflege- und Betreuungspersonal ist hoch.
Das haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen. Die Psychologin und BGW-Referentin für Psychologie Dr. Mareike Adler hat erklärt, warum das Gesundheits- und Sozialwesen besonders von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Mit Mareike spreche ich gleich wieder. Wir klären die Frage, was Betroffene – und vor allem Betriebe – machen können, wenn der Übergriff nachwirkt. Reden wir also gleich über die Individualprävention traumatischer Ereignisse.
Moderator:
Die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer von Gewalt wird, ist im Gesundheitswesen hoch. Völlig egal, ob man in der Behindertenhilfe arbeitet, in Kliniken, in der Pflege oder in psychiatrischen Einrichtungen. Krass finde ich zum Beispiel die ermittelten Zahlen zur sexualisierten Gewalt – darüber haben wir in der letzten Herzschlag-Folge gesprochen. Heute schauen wir uns die Prävention der psychischen Folgen von Übergriffen an und was man dafür tun kann. Denn zielgerichtete Präventionsmaßnahmen, die auf einzelne Personen zugeschnitten sind, können deren psychische Gesundheit am Arbeitsplatz schützen. Die sogenannte Individualprävention von Traumafolgen. Die soll verhindern, dass der Schock über Gewalt und Extremereignisse nachhaltig ist, psychische Erkrankungen entstehen, wieder auftreten oder sich verschlimmern. Bei mir ist die Diplom-Psychologin und BGW-Referentin für Psychologie Dr. Mareike Adler. Hallo, Mareike.
Dr. Mareike Adler:
Hallo Ralf, grüß dich.
Moderator:
Mareike, durch ein Extremereignis, zum Beispiel in Form eines Gewaltereignisses, können ein psychisches Trauma sowie nachfolgende sogenannte Trauma-assoziierte psychische Erkrankungen entstehen. Was läuft bei Menschen ab, die so etwas erleben?
Dr. Mareike Adler:
Ich steig vielleicht gleich mal mit einem Beispiel ein: Es hat einen Übergriff in einer Notaufnahme gegen einen Beschäftigten gegeben. Der ist in der Situation körperlich verletzt worden; es war sehr tumultartig, sehr unübersichtlich, und der Mitarbeiter hatte das Gefühl absoluter Hilflosigkeit – ein Ausnahmezustand. Wenn wir uns diese Situation vor Augen führen, verknüpft mit Hilflosigkeit und Ausnahmezustand, dann war das für den Mitarbeiter nicht nur körperlich verletzend, sondern es hat auch zu einer Traumatisierung geführt – ein traumatisches Ereignis mit psychischer Traumatisierung.
Innerlich läuft da eine ganze Menge ab: große Hilflosigkeit, Angst, Ohnmacht, Todesangst. Dieses Tohuwabohu kann auch länger anhalten. Nach einem traumatischen Ereignis kann sich eine akute Stressreaktion zeigen. Die kann ganz unterschiedlich aussehen und unterschiedlich lange dauern – von wenigen Stunden bis zu einigen Tagen. Menschen können wie betäubt, desorientiert, taub und bewegungslos sein, sich völlig zurückziehen – oder sie reagieren mit erhöhter Aktivität: hoher Puls, schnelle flache Atmung, Schweißausbruch, Schwindel, Wut, Verzweiflung – oder auch ruhig und äußerlich gefasst. Das erzähle ich als Hilfestellung für Praxis und Betroffene: Reaktionen auf Extremereignisse sind sehr unterschiedlich. Und ja, je nachdem, wie die weitere Verarbeitung läuft, kann es sein, dass Menschen längerfristig psychische Erkrankungen davontragen.
Moderator:
Bitte erklär mal, wie die Individualprävention von Traumafolgen genau aussieht. Was ist das?
Dr. Mareike Adler:
Bleiben wir beim Fallbeispiel: körperliche Verletzung plus Psychotrauma.
Sinnvoll ist, die Situation als Arbeitsunfall zu melden. Nach der Unfallmeldung bekommen Menschen Angebote von der Unfallversicherung – bei uns also von der BGW. Da beginnt die Individualprävention: Es geht darum, die psychischen Folgen des Extremereignisses möglichst gering zu halten. Das können unterschiedliche Angebote sein – z. B. telefonisch-psychologische Beratung. Zur Individualprävention gehört aber auch, die Person bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz gut aufzunehmen und zu unterstützen – beim Wiedereinstieg und beim Verbleib. Wesentlich ist: Sie ist stark an der betroffenen Person ausgerichtet. Also immer gucken: Was braucht mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin gerade? Wie können wir bestmöglich unterstützen?
Moderator:
Sind die obersten Ziele bei der Individualprävention von Traumafolgen, eine Verschlimmerung oder ein Wiederaufleben der psychischen Folgen zu verhindern? Und was gibt’s noch?
Dr. Mareike Adler:
Genau. Der Gesundheitsschaden soll möglichst ausbleiben oder gering bleiben.
Wichtig ist die Passung der Maßnahmen zur Person. Außerdem müssen die Verhältnisse im Betrieb so gestaltet sein, dass z. B. die Person aus der Notaufnahme gut zurückkommen kann und sich befähigt fühlt.
Wir sprechen gleich über betriebliche Schutzfaktoren – was beim Rückkehr- und Verbleibsprozess unterstützt.
Moderator:
Wer ist überhaupt die Zielgruppe für Individualprävention von psychischen Traumafolgen? Für wen ist das was?
Dr. Mareike Adler:
Vorrangig für diejenigen, die aufgrund ihres Jobs gefährdet sind, Extremereignisse zu erleben. Bei der BGW sind das leider viele: Rettungsdienste, Notaufnahmen, Beschäftigte in Psychiatrien und Krankenhäusern, in der Behinderten- und Jugendhilfe.
Für alle, die gefährdet sind – und natürlich für alle, die bereits einen Arbeitsunfall mit Gewalt erlebt haben. Für sie ist Individualprävention ein sinnvoller Ansatz, weiter zu schützen und zu stützen.
Moderator:
Kann man es so auf den Punkt bringen: Wer mit vielen Menschen zusammenarbeitet, hat auch ein höheres Gewaltpotenzial?
Dr. Mareike Adler:
Absolut – viele Menschen und viele Ausnahmesituationen. Menschen in Krisen reagieren oft anders – manchmal auch gefährlicher. Vielleicht noch ein interessanter Fakt: Mit Blick auf den Klimawandel gehen wir von steigenden Temperaturen aus – und steigende Temperaturen gehen oft mit einer Zunahme von Gewalt und Aggression einher. Darauf müssen wir uns einstellen.
Moderator:
Ja, auch interessant: Je heißer es wird, desto mehr gibt’s auf die Omme.
Das heißt: Das Wartezimmer ist voll, die Arbeit ist belastend – und nach drei, vier Stunden Wartezeit werden Menschen nicht nur sauer, sondern dank Hitze auch aggressiv.
Dr. Mareike Adler:
Absolut. Deshalb ist es sinnvoll, früh anzusetzen: Wartemanagement gut gestalten – Transparenz über Wartezeiten, Prioritäten, Überblick in der Notaufnahme.
Es gibt viele organisatorische Ansatzmöglichkeiten, Gewalt zu reduzieren. Das gehört auch zur Individualprävention: Traumafolgen abpuffern und das erneute Auftreten von Gewalt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern.
Moderator:
Vielleicht beim Krankenhaus-Neubau die Klimaanlage mitdenken – wenn’s nicht 40 Grad im Warteraum hat, ist die Wut vielleicht geringer. Oder man stellt viele Ventilatoren hin. Welche psychologischen Hilfsangebote gibt es von der BGW?
Dr. Mareike Adler:
Die BGW hat eine breite Palette:
– Telefonisch-psychologische Beratung nach Meldung bei der zuständigen Bezirksverwaltung, wenn man ein Extremereignis bei der Arbeit erlebt hat.
– Psychotherapeutische Angebote der gesetzlichen Unfallversicherung, die die BGW steuert – ebenfalls über die Bezirksverwaltung.
– Organisationsberatung, um das Auftreten von Gewalt zu reduzieren und Extremereignisse zu vermeiden.
Dr. Mareike Adler:
Das Thema Individualprävention psychischer Folgen ist für die BGW und die Unfallversicherungsträger noch recht neu.
Wir wissen aber inzwischen, welche Schutzfaktoren im Betrieb Menschen davor schützen, dass sich eine psychische Erkrankung manifestiert (chronifiziert), wieder auflebt oder sich verschlimmert.
Es sind drei:
- Soziale Unterstützung,
- ein Sicherheitsgefühl wiederherstellen,
- Möglichkeiten zur Offenbarung geben.
Konkret:
– Offenbaren: eine Anlaufstelle im Betrieb, an die ich mich wenden kann, wenn es mir nicht gut geht.
– Sicherheit/Kontrolle: Das subjektive Gefühl von Kontrolle ist enorm wichtig, damit Menschen psychisch stabil bleiben.
– Soziale Unterstützung: das Miteinander – Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzte. Das kann emotionale Unterstützung sein (Trost, Anteilnahme), ganz praktische Hilfe (mit anpacken, Fahrdienste zur Therapie, Schichten übernehmen), Dienstpläne anpassen, vermeiden, dass Betroffene gleich wieder in das Zimmer müssen, in dem der Übergriff stattfand, und Informationen zu weiteren Hilfen zusammentragen.
Diese drei Schutzfaktoren gilt es im Betrieb zu stärken. Wir arbeiten daran, daraus konkrete Handlungsempfehlungen für Betriebe und Führungskräfte zu machen – und ich hoffe, beim Gewaltsymposium noch mehr Konkretes berichten zu können.
Moderator:
Wie seid ihr auf die betrieblichen Schutzfaktoren gekommen? Warum genau diese?
Dr. Mareike Adler:
Wir haben uns intensiv gefragt: Was schützt wirklich die psychische Gesundheit nach einem Psychotrauma?
Dazu haben wir medizinische Leitlinien gesichtet, empirische Studien gewälzt, wissenschaftliche Modelle herangezogen – und praktische Ansatzpunkte gesucht, auf die man in der betrieblichen Praxis Einfluss hat. So sind wir auf die drei gekommen: Anlaufstelle, Sicherheits-/Kontrollerleben und soziale Unterstützung.
Moderator:
Bietet die BGW Individualpräventions-Angebote zu Traumafolgen an?
Dr. Mareike Adler:
Ja, für Betroffene gibt es bereits einiges:
– Telefonisch-psychologische Beratung und psychotherapeutische Angebote,
– Bezuschussung der Ausbildung zur kollegialen Erstbetreuung,
– ein Seminar zum Schutz vor sexueller Belästigung für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (Führungskräfte und Arbeitsschutzakteure).
Und wir arbeiten an weiteren Angeboten, die konkret an den drei Schutzfaktoren ansetzen und Betroffene adressieren. Ziel ist immer, die betrieblichen Schutzfaktoren zu optimieren und überhaupt zu installieren.
Moderator:
In der letzten Podcast-Folge haben wir gehört, dass gerade Menschen mit Behinderung oft Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Mit Blick auf die Individualprävention: Sieht die für Menschen mit Behinderung anders aus?
Dr. Mareike Adler:
Nein, eigentlich nicht. Unabhängig von Behinderung gilt: Es braucht die Passung zwischen betroffener Person und den betrieblichen Maßnahmen. Unterschiede mache ich da keine.
Moderator:
Wenn es im Gesundheitsdienst so viele Fälle von Gewalt gibt – was kommt da auf uns zu? Stichworte: Berufsausfälle, verängstigte Beschäftigte, Kündigungen, wenn man einfach die Schnauze voll hat.
Dr. Mareike Adler:
Die Situation ist herausfordernd: Gewalt, Klimawandel, Fachkräftemangel – mehr Last auf weniger Schultern. Umso wichtiger ist, Gewalt zu verhindern, Angebote vorzuhalten, wenn es doch zu Übergriffen kommt, und Gewaltpräventionskonzepte zu etablieren. Mehr Druck bedeutet auch: mehr Bewegung in Richtung Schutzkultur. Mein Appell: Denkt an euch, an die Kolleginnen und Kollegen – und besonders die Führungskräfte müssen hinschauen: Wie geht’s den Leuten, die hier den Laden am Laufen halten? Äußere Merkmale sieht man oft früh – dazu sollte es gar nicht erst kommen.
Moderator:
Vielen Dank für deine ganzen Infos, Dr. Mareike Adler.
Dr. Mareike Adler:
Vielen Dank auch für die Zeit.
Moderator:
„Gemeinsam aktiv gegen Gewalt, Aggression und Belästigung“ – das ist das Motto des BGW-Gewaltsymposiums vom 6. bis 7. November in Dresden. Einige Programmpunkte werden auch online übertragen. Beim BGW Symposium werden rund 800 Teilnehmende vor Ort und im Livestream dabei sein. Es werden Gewaltschutzkonzepte in verschiedenen Branchen des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege beleuchtet, Beratungs- und Unterstützungsangebote der BGW und anderer Beteiligter vorgestellt – und wir setzen gemeinsam ein starkes Signal gegen Gewalt, Aggression und Belästigung am Arbeitsplatz. Antworten gibt’s u. a. auf die Fragen: Welche Berufsgruppen sind besonders gefährdet? Welche Unterstützungsangebote gibt es in der Behindertenhilfe, in Kliniken, der Pflege oder in psychiatrischen Einrichtungen?
Was ist Individualprävention psychischer Traumafolgen? Was ist das Netzwerk „Sicher im Dienst“? Verschiedene Workshops helfen praxisnah – zum Beispiel Deeskalationsmanagement im Krankenhaus, der richtige Umgang mit bedrohlichen Situationen im Dienst oder wie Gewaltschutz gelingt mit einem internen Sicherheitsdienst aus Beschäftigten. Es gibt auch Hilfen für körperliches Deeskalationsmanagement und Tipps, wie man rauskommt aus der Opferkörperhaltung. Seid gut vorbereitet für eure Schicht – und nehmt am Gewaltsymposium teil.
Wenn ihr mehr zum Thema sexualisierte Gewalt oder zum BGW Gewaltsymposium wissen wollt, klickt die Links in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, es ist ein wichtiges Thema – darum gibt’s hierzu verschiedene Herzschlag-Folgen. Hört sie euch gern an. Gibt’s überall, wo’s Podcasts gibt – und natürlich auf der BGW-Website www.bgw-online.de/podcast. Abonniert diesen Podcast gern, bewertet ihn und lasst einen Kommentar da – wir freuen uns drauf. Die nächste Folge hört ihr wie immer in zwei Wochen. Bis dahin!
Jingle:
Herzschlag! Für ein gesundes Berufsleben – der BGW-Podcast.