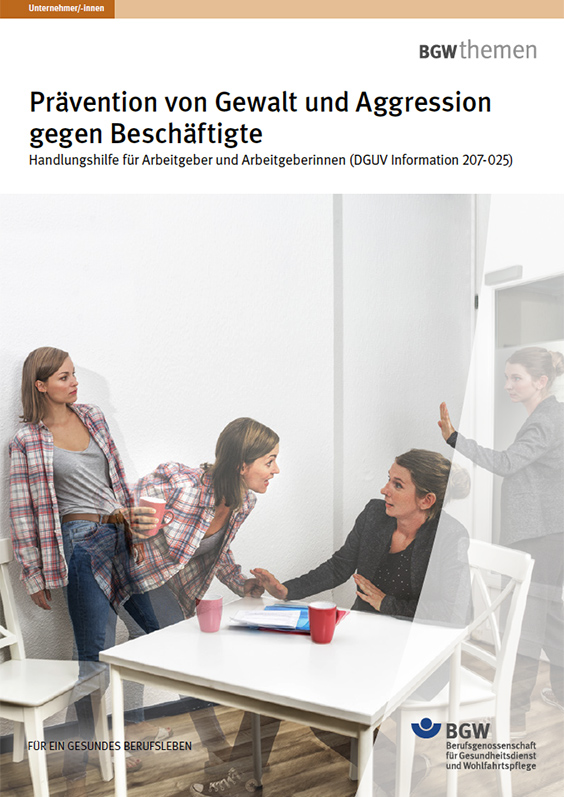Moderator :
Alle Beschäftigten haben einen Anspruch auf einen Arbeitsplatz ohne Gefährdung.
Alle sollten aufeinander achten und die Kolleginnen und Kollegen sowie die Patientinnen und Patienten respektieren. Natürlich im gegenseitigen Verständnis.
Wunderbar! So ist doch alles prima im Job. Und zack ist diese Podcast-Folge auch schon vorbei. Tschüssi!
Redaktion:
Äh, Moderator , bitte lies den Text noch etwas weiter.
Moderator :
Äh, ach so. Moment, da steht noch eine Seite. Ja, okay, ja, verstehe. Ja, war ja wieder klar. Es hätte so einfach sein können, aber hier steht nämlich noch: In einer Jugendhilfeeinrichtung wird eine Pädagogin während des Nachtdienstes von einem Jugendlichen gewürgt. In einem Pflegeheim bespuckt und schlägt eine demente Bewohnerin immer die Pflegekräfte bei ihrer Arbeit. Und in der Notaufnahme begrapscht ein Betrunkener die Ärztin und droht, sie zu vergewaltigen. Ich sehe schon, jetzt ist diese Podcastfolge doch nicht so schnell vorbei. Denn leider kommt es gerade dort, wo Menschen für andere Menschen tätig sind, häufiger zu Übergriffen. Körperlich und verbal.
Redaktion:
Ganz genau, Ralf . Und weiter geht’s.
Moderator :
Aggressivität und Gewalt sind Bestandteil menschlicher Ausdrucks- und Verhaltensweisen. Leider ist das so. Auch im Gesundheitsdienst ereignen sich Konflikt- und Krisensituationen, in deren Verlauf Mitarbeitende physisch oder psychisch verletzt werden. Nur weil es hier öfter geschieht, dürfen Übergriffe nicht als normal angesehen werden.
Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin, Gefährdungen zu ermitteln und ihnen systematisch vorzubeugen. Was können Betriebe tun, um Risiken zu minimieren? Wie geht man damit um, wenn Patientinnen und Patienten oder auch zu Pflegende zur Gefahr werden? Unser Thema heute ist die Gewaltprävention und die Nachsorge, gerade auch bei sexualisierter Gewalt. Auf jeden Fall hilft die BGW. Denn bei einem Übergriff auf Beschäftigte – egal ob jetzt am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin – kann es sich um einen Arbeitsunfall handeln. Die untersuchte Belästigung während eines ganzen Jahres offenbarte diese Zahlen aus der Behindertenhilfe, den Kliniken, der Pflege oder psychiatrischen Einrichtungen: Sexuelle Handlungen haben bis zu 73 Prozent der Beschäftigten gesehen. Anzügliche oder beleidigende Sprüche ertragen mussten bis zu 75 Prozent. Und unsittlich berührt oder körperlich gedemütigt wurden bis zu 53 Prozent der im Gesundheitssystem Arbeitenden.
Bei diesen Zahlen kann man sagen: Man geht zu seinem Job, um anderen zu helfen – und die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer von sexualisierter Gewalt wird, die ist hoch. Das betrifft übrigens Frauen und Männer. Und da gehen einige mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit, auf jeden Fall. Wie können wir das ent-mulmen?
Bei mir ist Diplom-Psychologin und BGW-Referentin für Psychologie, Dr. Mareike Adler. Ich grüße dich.
Dr. Mareike Adler:
Hallo, ich grüße dich ebenfalls.
Moderator :
Was genau sexualisierte Gewalt und Belästigung bei der Arbeit ist, das haben wir ja schon mal in einer Herzschlag-Folge geklärt – auch mit Handlungsempfehlungen. Hört da gerne noch mal rein in die Folge „Sexuelle Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz“.
Das Thema wird jedoch immer größer und bekommt nun auch immer mehr Aufmerksamkeit. In den Medien erfahren wir regelmäßig von Übergriffen gegen Mitarbeitende im Gesundheitswesen.
Ich habe ja auch eben ein paar Daten und Fakten erwähnt – alarmierende Zahlen. Was kannst du dazu noch ergänzen, Mareike ?
Dr. Mareike Adler:
Ja, die Zahlen sind in der Tat hoch. Das ist nicht gut. Das macht doch einen Handlungsbedarf deutlich. Letztendlich steckt ja hinter jeder Zahl immer auch eine betroffene Person: eine Pflegekraft, die in ein Zimmer reinkommt, und da ist ein älterer Herr, der anfängt zu onanieren – eine unangenehme Situation für die Pflegekraft. Oder nur beim Aufsetzen rutschen die Hände des Patienten – ich sag mal – aus Versehen ab und streichen über die Brust einer Pflegefachkraft. Das sind ja unangenehme Situationen.
Und in der Tat ist das Gesundheits- und Sozialwesen stark betroffen. Das zeigt auch der Vergleich mit anderen Branchen.
Wir hören auch von Belästigung durch Vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen. Die gute Nachricht ist aber: Es gibt Handlungsmöglichkeiten für Betriebe, es gibt Handlungsmöglichkeiten für Betroffene und auch für Angehörige. Insofern sind wir dem nicht ausgeliefert und können im Gesundheits- und Sozialwesen Schutz für Beschäftigte aufbauen.
Moderator :
Reflexhaft argumentieren beim Thema sexualisierte Gewalt ja ein paar Menschen, die das immer noch nicht wahrhaben wollen, mit dem Argument: „Ja, das ist doch alles nicht so schlimm. Jetzt wird halt jeder Pfiff hinter einem Arztkittel gleich mitgezählt – und dann ist die Statistik natürlich schlimm.“ Was sagst du denen?
Dr. Mareike Adler:
Letztendlich geht es darum, wie die Person, die das erlebt, das Ganze wahrnimmt. Wenn es eine gefühlte Grenzüberschreitung ist und eine Verletzung der Würde, dann kann das durchaus sexuelle Belästigung sein.
Und sexuelle Belästigung hat negative Folgen für die psychische und körperliche Gesundheit. Insofern ist das überhaupt nicht okay und auch nicht kleinzureden, sondern sehr ernst zu nehmen.
Über diese Folgen hinaus – dass man sagen kann, das wollen wir nicht – haben Beschäftigte auch ein Recht darauf, am Arbeitsplatz vor sexueller Belästigung und Gewalt geschützt zu werden, beispielsweise durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und es gibt das Arbeitsschutzgesetz, das sehr deutlich formuliert, dass Arbeitgeber die psychische und körperliche Gesundheit der Beschäftigten zu schützen haben und Gefährdungen reduzieren müssen.
Dazu gehört natürlich auch, Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz zu beseitigen. Insofern ist das Recht tatsächlich auf der Seite der Betroffenen.
Wir erleben aber zeitgleich noch eine gewisse Tabuisierung und Bagatellisierung – im Gesundheits- und Sozialwesen, aber auch in anderen Branchen. Solche Erlebnisse werden als „Ach komm, das ist halt Teil des Jobs, stell dich nicht so an“ eingeschätzt.
Aber wir leisten – auch hier mit unserem Podcast – hoffentlich einen guten Beitrag, aufzuzeigen: Das ist ein gravierendes Thema, das wir ernst nehmen müssen. Und es besteht ein Recht auf Schutz.
Moderator :
Ja, das Bagatellisieren – das hast du eben angesprochen. Das kriegt man halt so jeden Tag ab und dann wird es irgendwann normal. Das ist dann ja auch gefährlich für die eigene Psyche, oder?
Dr. Mareike Adler:
Ja, absolut. Du sprichst die Folgen an. Viele Betroffene berichten von Scham, Ekel. Manche machen sich auch selber Vorwürfe. Wir sehen auch Vermeidungsverhalten, was sehr belastend sein kann: dass bestimmte Dinge regelhaft vermieden werden, bestimmte Bereiche des Unternehmens nicht betreten werden oder sich Rituale entwickeln wie häufiges Händewaschen. Wir wissen aus unseren eigenen Studien: Je häufiger sexuelle Belästigung und Gewalt bei der Arbeit erlebt wird, desto stärker nimmt die Befindensbeeinträchtigung zu – die Psyche leidet. Menschen berichten von emotionaler Erschöpfung, also dass sie sich ausgelaugt fühlen, von zunehmender Depressivität, aber auch psychosomatischen Beschwerden wie Rücken- oder Kopfschmerzen und Verspannungen.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass sexualisierte Gewalt und Belästigung Menschen so weit psychisch überfordern kann, dass daraus Traumata entstehen können – nicht müssen, aber können – und damit Folgeerkrankungen möglich sind. Auch aus diesem Blickwinkel ist das Thema sehr relevant: Betriebe brauchen psychisch und körperlich gesunde Beschäftigte, die leistungsfähig und motiviert sind. Und Beschäftigte selbst möchten gesund bleiben und vor Gesundheitsgefahren wie Belästigung bei der Arbeit geschützt werden.
Moderator :
Warum ist das Gesundheits- und Sozialwesen besonders von sexualisierter Gewalt betroffen?
Dr. Mareike Adler:
Da gibt es Faktoren, die das begünstigen – und die sind im Gesundheits- und Sozialwesen besonders häufig vorhanden.
Erstens: körperliche und emotionale Nähe im Berufsalltag. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das ausnutzt und belästigt – ob bewusst oder unbewusst, etwa aufgrund einer Einschränkung oder Erkrankung.
Zweitens: die Arbeit mit Menschen in herausfordernden Lebenssituationen.
Drittens: hierarchische Abhängigkeiten – im Betreuungskontext, wo eine zu betreuende Person abhängig ist von Pflege, aber auch zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Das alles kann belästigendes Verhalten begünstigen.
Und viertens: die noch vorhandene Bagatellisierung und Tabuisierung. Sätze wie „Das ist Teil des Jobs“ oder „Wenn du das nicht aushältst, bist du hier falsch“ hören wir immer wieder. Da liegt noch ein Weg vor uns.
Moderator :
Männer sind bei der nonverbalen Kommunikation eher Opfer sexualisierter Gewalt, Frauen bei der verbalen und körperlichen Gewalt. Ich möchte es nicht kleinreden, aber kann man schon sagen, dass Frauen es bei sexualisierter Gewalt doller abbekommen?
Dr. Mareike Adler:
Grundsätzlich zeigen viele Untersuchungen: Frauen sind deutlich stärker betroffen.
Aber du hast recht: Wir von der BGW haben eine Untersuchung durchgeführt und ganz neu die nonverbale Belästigung in den Blick genommen – also Gesten, Blicke, alles ohne Sprache und ohne Körperkontakt mit sexuellem Touch, das als Grenzüberschreitung erlebt wird. Und da war der überraschende Befund: Männer sind ein bisschen stärker betroffen als Frauen. Das ist eine Studie – aber ein Fingerzeig, die Belästigung gegen Männer mit in den Blick zu nehmen und in Präventions- und Nachsorgekonzepten Männer ausdrücklich mitzudenken.
Moderator :
Eine neue Studie zeigt, dass vor allem auch Menschen mit Behinderung oft Opfer sind. Die BGW versichert Beschäftigte mit Behinderung. Wie funktioniert hier der Schutz am besten?
Dr. Mareike Adler:
Richtig. Wir als BGW versichern auch Menschen mit Unterstützungsbedarf. Leider sind Vorkommnisse an Belästigung gegen Menschen mit Behinderung noch mal höher als bei Menschen ohne Unterstützungsbedarf. Hier besteht Handlungsbedarf.
Der Schutz funktioniert im Grunde wie in allen anderen Bereichen: Enorm wichtig ist, dass die Unternehmensleitung das Thema auf der Agenda hat, es als Chefsache verankert und eine Kultur schafft, in der sexuelle Belästigung nicht akzeptiert wird, geahndet wird, regelmäßige Schulungen stattfinden und ein Schutzkonzept vorliegt.
Ein solches Gewaltschutz- bzw. Schutzkonzept denkt den Fall vor:
– Prävention: z. B. Gefährdungsbeurteilung.
– Akutmaßnahmen: Was tun wir, wenn es zum Fall gekommen ist? Notfallpläne.
– Nachsorge: Was tun wir danach?
Sinnvoll ist auch, eine Anlaufstelle mit Verschwiegenheit vorzuhalten – intern oder extern –, an die sich Betroffene und Beobachtende vertraulich wenden können.
Zusätzlich ist eine Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vorgeschrieben (die aber nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet ist). Deshalb braucht es ergänzend die vertrauliche Anlaufstelle. Und: konsequente Maßnahmen, wenn es zu sexualisierter Belästigung oder Gewalt gekommen ist.
Moderator :
Was können Verantwortliche machen, um ihre Mitarbeitenden zu schützen?
Dr. Mareike Adler:
Führungskräfte haben mehrere Hebel:
– Wachsamkeit im Alltag: Auffälligkeiten bei Klientinnen/Klienten erkennen, die zu sexualisierter Belästigung neigen könnten; ebenso Auffälligkeiten bei Beschäftigten wahrnehmen (z. B. Meidungsverhalten).
– Teamkommunikation: Thema regelmäßig in Teambesprechungen ansprechen, zu frühzeitigen Meldungen ermutigen, bei Dokumentation und Hilfsangeboten unterstützen.
– Gefährdungsbeurteilung Gewalt häufiger durchführen, gerade in stärker gefährdeten Bereichen.
– Maßnahmen ableiten:
- Substitution/Vertragsgestaltung: Wenn möglich, Verträge mit Personen, die zu Übergriffen neigen, nicht verlängern oder beenden.
- Technische/bauliche Maßnahmen: Rückzugsräume, bauliche Anpassungen, Alarmsysteme.
- Organisation: Alleinarbeit vermeiden; Doppelbesetzung; andere Zuordnung, wenn mit einer Person weniger Risiken bestehen.
- Personenbezogen: Schulungen – aber das ist das letzte Mittel, nicht das erste.
Moderator :
Die BGW hält für Versicherte psychologische Hilfsangebote bereit – für alle, die einen Arbeitsunfall mit psychischen Unfallfolgen erlitten haben. Wie sieht die Hilfe aus?
Dr. Mareike Adler:
Menschen, die einen sexuellen Übergriff bei der Arbeit erleben, sollen das melden und erhalten das Angebot einer telefonischen psychologischen Beratung durch psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten – bis zu fünf Sitzungen über die zuständige BGW-Bezirksverwaltung. Arbeitsunfälle werden geprüft. Wird deutlich, dass weitergehende psychotherapeutische Unterstützung nötig ist, sind weitere Behandlungen im Psychotherapeutenverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung möglich – ambulant oder stationär.
Außerdem gibt es das Angebot der kollegialen Erstbetreuung, das Betriebe installieren können. Die BGW unterstützt die Ausbildung finanziell. Das ist wertvoll, weil diese Personen nach einem Ereignis erste Betreuung leisten, für Ruhe sorgen, basale Bedürfnisse (Essen, Trinken) im Blick haben und Kontakt zu Angehörigen aufnehmen. Diese erste Betreuung ist enorm wichtig – und sie etabliert sich in immer mehr Betrieben.
Moderator :
Nicht nur Patientinnen und Patienten oder zu Pflegende stehen im Fokus – auch Vorgesetzte oder Kolleginnen und Kollegen. Also auch die können sexualisierte Gewalt verursachen.
Dr. Mareike Adler:
Leider ja. Je hierarchischer eine Organisation, desto höher das Risiko für Gewalt und Belästigung durch Kolleginnen, Kollegen oder Vorgesetzte – beispielsweise in Kliniken.
Ich habe z. B. einer jungen Frau in Ausbildung zugehört, die häufiger Übergriffe erlebt: sexuelle Anspielungen, Berührungen, anzügliche Komplimente, Pfiffe – bis hin zu einer Bedrängung im Aufzug durch einen Arzt. Dem Thema widmen wir uns aktuell intensiver; es läuft eine Studie, und ich werde auf dem Gewaltsymposium neueste Zahlen berichten.
Schon jetzt sehen wir – über nonverbale, gesprochene Belästigung und körperliche Berührungen hinaus – zwei weitere Phänomene:
- Sexueller Zwang: persönliche oder berufliche Vorteile versprechen, wenn sich jemand sexuell gefällig verhält; Einladungen so platzieren, dass bei Ablehnung Nachteile drohen.
- Diskriminierung aufgrund des Geschlechts: etwa wenn die Kompetenz einer angehenden Oberärztin in der Chirurgie aufgrund ihres Geschlechts infrage gestellt wird. Auch dem widmen wir uns intensiver.
Moderator :
Meine Vorgesetzten sollen mich ja beschützen. Was mache ich, wenn genau dort das Problem liegt? Zu den Vorgesetzten kann ich dann nicht gehen.
Dr. Mareike Adler:
Das ist oft eine sehr unangenehme Situation wegen Abhängigkeiten. Wenn möglich, ist es sinnvoll, klare Grenzen zu setzen, z. B.: „Sie haben mich gerade angefasst, das möchte ich nicht. Lassen Sie das.“ Das Verhalten benennen, als übergriffig einstufen, Unterlassung fordern. Ich weiß, das ist schwer. Deshalb: Dokumentieren und sich an eine vertrauliche Beratungsstelle wenden, die über Einordnung und Optionen aufklärt: Ist das Belästigung? Welche Wege habe ich? Was folgt etwa aus einer Beschwerde bei der AGG-Beschwerdestelle? Wer erfährt was? Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es? Mit voller Information kann die betroffene Person entscheiden, wie sie vorgehen möchte.
Im Extremfall kann es sinnvoll sein, die Reißleine zu ziehen und die Stelle zu wechseln – das ist aber das letzte Mittel. Hilfreich sind außerdem externe rechtliche und ggf. psychologische Unterstützung. Wichtig: Das Problem kann die betroffene Person nicht allein lösen. Es braucht Arbeitgeber und Führungskräfte, die schützen.
Moderator :
Ich würde auch sagen: Wenn die direkte Führungskraft das Problem ist, dann – bevor man die Stelle wechselt und die Person einfach weitermachen kann – holt man sich Hilfe von einer anderen Führungskraft, damit das nicht immer so weitergeht.
Dr. Mareike Adler:
Genau.
Moderator :
Was ist beim BGW Gewaltsymposium geplant?
Dr. Mareike Adler:
Wir haben eine ganze Menge geplant – einen bunten Strauß. Einiges ist schon auf der Homepage zu lesen. Es gibt einen Blick in das Gewaltschutzkonzept eines großen Trägers in Deutschland (Impulsvortrag). Das Netzwerk „Sicher im Dienst“ stellt sich vor – mit Angeboten und Kampagne. Zahlreiche Workshops: erste Schritte zum Gewaltschutzkonzept, Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung Gewalt und Belästigung. Das Tolle: Man kann in Präsenz teilnehmen oder virtuell per Videokonferenz.
Moderator :
Was sicher auch wichtig ist: Beim Gewaltsymposium können sich viele Teilnehmende untereinander austauschen.
Dr. Mareike Adler:
Ja, genau. Es gibt Möglichkeiten, in Pausen und in Workshops in den Austausch zu gehen – Erfahrungen und Good Practice zu teilen.
Namhafte Expertinnen und Experten berichten über aktuelle Erkenntnisse, und es gibt viele Praxisbeispiele.
Moderator :
Was sind Beispiele für Workshops? Was kann man lernen?
Dr. Mareike Adler:
Viel Praktisches: ein Vortrag zu „Gewaltereignis – was nun?“ mit Anwendungsbeispielen zu Unterstützungsangeboten; außerdem Praxisworkshops zum Deeskalationsmanagement oder zu Nachsorgegesprächen.
Moderator :
Vielen Dank, Dr. Mareike Adler.
Dr. Mareike Adler:
Danke auch.
Moderator :
Wenn ihr mehr zum Thema sexualisierte Gewalt oder zum BGW-Gewaltsymposium wissen wollt, klickt in die Links in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Natürlich empfehle ich euch auch die weiteren Herzschlag-Folgen zu diesen Themen – und selbstverständlich den ganzen Podcast. Schaut mal auf die BGW-Website www.bgw-online.de. Dort findet ihr alle Folgen zum Nachhören. Natürlich gibt es diesen Podcast auch überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich mal abonnieren und auch gerne bewerten. Die nächste Folge hört ihr wie immer in zwei Wochen. Bis dahin!
Jingle:
Herzschlag! Für ein gesundes Berufsleben – der BGW-Podcast.