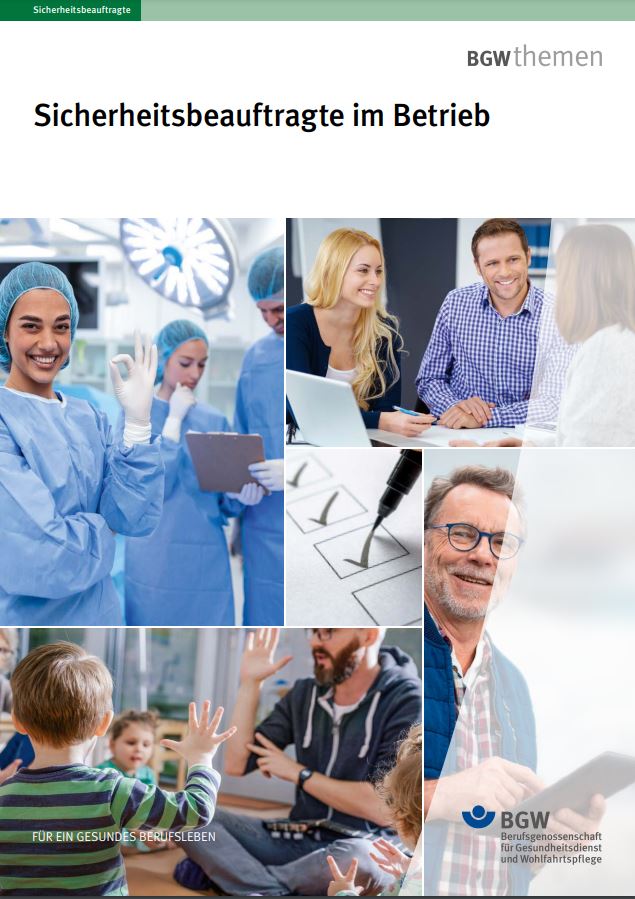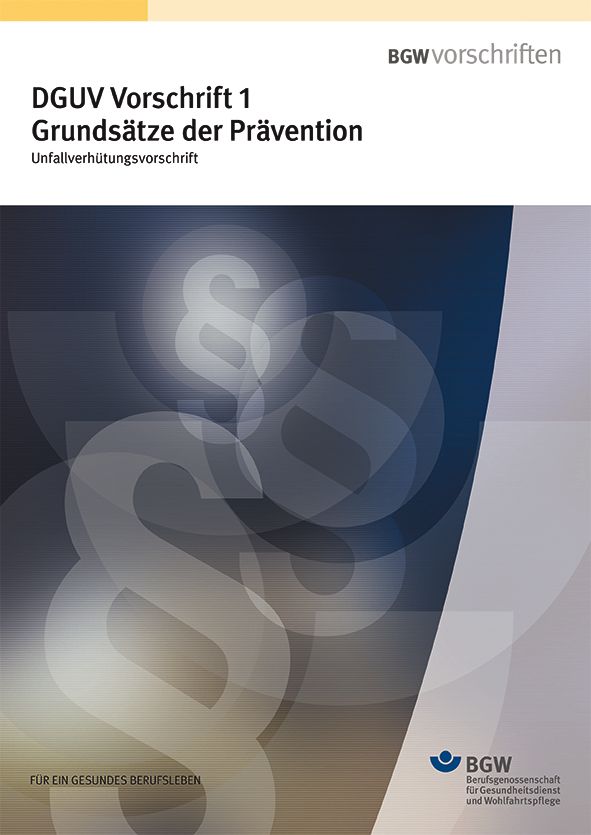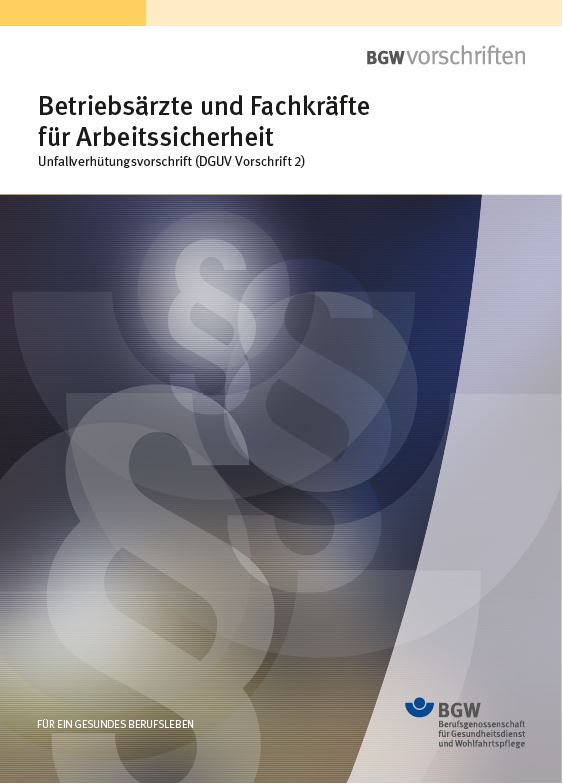So ermitteln Sie die Zahl der Sicherheitsbeauftragten Kriterien für Ihren Betrieb
Betriebe mit über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen Sicherheitsbeauftragte bestellen. Mindestens eine Person, in größeren Betrieben, je nach Struktur und Gefährdungslage sind mehrere Sicherheitsbeauftragte erforderlich.
Die Anforderungen sind in der DGUV Vorschrift 1 „Grundlagen der Prävention“ beschrieben. Wie viele Sicherheitsbeauftragte sind konkret im Betrieb erforderlich? Hier finden sich fünf verbindliche Kriterien für die Praxis.
Ein Kriterium ist die Betriebsgröße. In der Praxis entscheidend ist, dass Sicherheitsbeauftragte präsent sind. Für Betriebe mit mehreren Betriebstätten oder Bereiche mit Schichtbetrieb müssen entsprechend mehr Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Die Sicherheitsbeauftragten sollten die Beschäftigten und die Arbeitsumgebung in ihrem Zuständigkeitsbereich kennen.
Fünf Kriterien für die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten
Kriterien für die Berechnung der Anzahl der Sicherheitsbeauftragten
Ein wesentliches Kriterium der DGUV Vorschrift 1 sind die im Unternehmen bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren: Je mehr potenzielle Gefährdungen identifiziert werden, desto eher kann sich in einzelnen Bereichen ein besonderer Bedarf an Sicherheitsbeauftragten ergeben. Konkrete Erkenntnisse zur Gefährdung im Unternehmen lassen sich über die Gefährdungsbeurteilung gewinnen.
- Grundsätzlich muss ab 21 Beschäftigten im Unternehmen mindestens ein Sicherheitsbeauftragter oder eine Sicherheitsbeauftragte bestellt werden.
- Ab 50 Beschäftigten sollten es mindestens zwei sein.
- Übrigens: In Kitas zählen die Kinder mit dazu.
In größeren Betrieben sind je nach Gefährdungslage entsprechend mehr Sicherheitsbeauftragte erforderlich. Betriebliche Gefährdungstypen sind in drei Gruppen eingeteilt: hohe, mittlere und niedrige Gefährdung.
Die branchenspezifische Gefährdungsgruppe Ihres Betriebes finden Sie in der DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ im Abschnitt „Betreuungsgruppen“, Anlage 2, Abschnitt 4.
Gruppe III: niedrige Gefährdung
Die meisten bei der BGW versicherten Betriebe gehören zur Gruppe mit niedriger Gefährdung.
- Hier sollten ab Größe von 250 Mitarbeitenden mindestens drei Sicherheitsbeauftragte zur Verfügung stehen.
- In größeren Betrieben sollten auf eine/n Sicherheitsbeauftragte/n 250 bis 350 Mitarbeitende kommen.
Gruppe II: mittlere Gefährdung
Betriebe mit mittlerer Gefährdung sind zum Beispiel Kliniken, Forschungseinrichtungen, Labore, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Küchen, Wäschereien und das Gebäudemanagement für stationäre ärztliche Einrichtungen sowie Schädlingsbekämpfungsbetriebe.
- Hier sollten ab Größe von 150 Mitarbeitenden mindestens drei Sicherheitsbeauftragte zur Verfügung stehen.
- In größeren Betrieben sollten auf eine/n Sicherheitsbeauftragte/n 75 bis 150 Mitarbeitende kommen.
Gruppe I: hohe Gefährdung
Hohe Gefährdungen treten in bei der BGW versicherten Betrieben in der Regel nicht auf.
- Hier sollten ab Größe von 100 Mitarbeitenden mindestens drei Sicherheitsbeauftragte zur Verfügung stehen.
- In größeren Betrieben sollten auf eine/n Sicherheitsbeauftragte/n 50 bis 125 Mitarbeitende kommen.
Ausgehend von diesen Richtwerten sind dann die weiteren Kriterien der räumlichen, zeitlichen und fachlichen Nähe zu betrachten.
"Räumliche Nähe" bedeutet, dass der oder die Sicherheitsbeauftragte als Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin erreichbar sein sollte. Nur so können sie die Situation in den Arbeitsbereichen selbst einschätzen.
Bei Filialen oder anderen räumlich getrennten Betriebsteilen werden damit unter Umständen weitere Sicherheitsbeauftragte nötig: Ist die räumliche Einheit klein und hat der Unternehmer oder die Unternehmerin die örtlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzbelange auf die dortige Leitung übertragen, sind in der Regel keine zusätzlichen Sicherheitsbeauftragten erforderlich.
In Betriebsstätten mit mehr als 20 Beschäftigten sollte dagegen zur Unterstützung der Leitung vor Ort ein eigener Sicherheitsbeauftragter bestellt werden – beziehungsweise je nach Beschäftigtenzahl auch mehrere SiB.
Das Kriterium "zeitliche Nähe" betrifft speziell Unternehmen mit Schichtbetrieb: Kennen die Sicherheitsbeauftragten die Arbeitsbedingungen und die Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in allen Schichten? Dann können sie ihre Aufgabe als SiB wahrnehmen, selbst wenn sie selbst nicht regelmäßig in jeder der Schichten arbeiten sollten. Allerdings sollte gewährleistet sein, dass zum Beispiel durch entsprechende Übergabezeiten in allen Schichten Kontakt- und Austauschmöglichkeiten mit den zuständigen Sicherheitsbeauftragten bestehen.
Bei der geforderten "fachlichen Nähe" kommen verschiedene Aspekte zum Tragen. Die Unternehmen sollten bei der Auswahl der Sicherheitsbeauftragten insbesondere darauf achten, dass diese die Mitarbeiterstruktur und die Gefährdungspotenziale des Arbeitsbereichs kennen.
In den betrieblichen Alltag übersetzt heißt das unter anderem, dass Sicherheitsbeauftragte in der Lage sein sollten, die Tätigkeiten im jeweiligen Arbeitsbereich einzuschätzen – das erfordert entsprechendes Wissen und Erfahrung. Auch über mögliche sprachliche oder kulturelle Besonderheiten hinweg sollten sie mit den Beschäftigten kommunizieren können. Und wer Kenntnisse im Arbeits- und Gesundheitsschutz seines Zuständigkeitsbereichs haben soll, muss natürlich auch in die betrieblichen Arbeitsschutzstrukturen eingebunden sein – und die Gefährdungsbeurteilung kennen.
In der Praxis kann sich beim Kriterium "fachliche Nähe" gegebenenfalls ein besonderer Bedarf an Sicherheitsbeauftragten ergeben. Beispiel Kliniken: Für Bereiche wie Pflege, OP, Intensiv oder Service ist von sehr unterschiedlichen Tätigkeiten und Strukturen auszugehen. Daher bietet es sich an, eigene Sicherheitsbeauftragte für die einzelnen Arbeitsbereiche vorzusehen. Es kann aber beispielsweise durchaus für verschiedene Pflegestationen ein gemeinsamer Sicherheitsbeauftragter benannt werden, wenn kein anderes Kriterium der DGUV Vorschrift 1 dagegenspricht.
In Werkstätten wiederum besteht eine besondere Herausforderung für Sicherheitsbeauftragte darin, die beschäftigten Menschen mit Behinderungen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten einzuschätzen und mit ihnen zu kommunizieren. Aus diesem Grund sind in erster Linie die Betreuerinnen und Betreuermit Sicherheitsfragen befasst. Doch auch Menschen mit Behinderungen können als Sicherheitsbeauftragte speziell qualifiziert werden. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben können sie zum Beispiel durch "Patinnen" oder "Paten" unterstützt und begleitet werden.