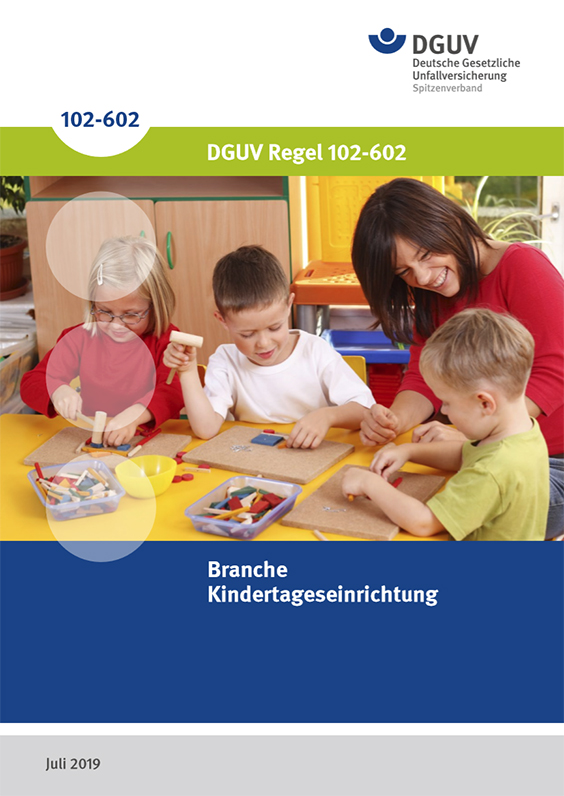Geht’s auch leiser? Maßnahmen gegen Lärm BGW magazin 4/2025

Lärm wirkt nicht nur direkt aufs Gehör (aural
), sondern auch indirekt auf Körper und Psyche (extraaural
).
Ist das laut hier!
Ein Satz, der in Kindertageseinrichtungen, Tagespflegeeinrichtungen für Seniorinnen und Senioren, Kantinen und großen Büroräumen regelmäßig zu hören ist. Doch Lärm ist nicht gleich Lärm, denn in diesen Fällen spielt die akustische Beschaffenheit der Räume eine große Rolle. Welche Maßnahmen es leiser machen können, zeigt das Beispiel Kita. Vieles lässt sich auch auf andere Branchen übertragen.
Wer schon einmal einen Tag in einer Kita verbracht hat, weiß: Kinder sind oft laut. Sie sollen es auch sein – sie sollen spielen, herumtoben und auch mal laut singen und musizieren. Doch neben ihrer Entwicklung darf die Gesundheit der Anwesenden nicht aus dem Blick geraten, sowohl die der Beschäftigten als auch die der Kinder.
Messungen der Schallpegel (siehe Artikel Alarm für die Ohren) belegen, dass eine gehörschädigende – "aurale" – Wirkung des Lärms in einer Kita mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Dafür treten andere Faktoren in den Vordergrund.
Lärm und Sprache
Eine Besonderheit in Kindertagesstätten ist, dass es für die intensive Betreuung vor allem auf die verbale Zuwendung ankommt. Die sprachliche Verständigung ist jedoch durch hohen Störschall erheblich erschwert oder nur mit erhöhtem Stimmaufwand möglich. Beides führt dazu, dass sich am Ende des Tages eine gewisse Müdigkeit und Erschöpfung bei den Erzieherinnen und Erziehern einstellt. Auch für die Kinder stellt Lärm eine Beeinträchtigung dar, denn gerade in diesem Alter steht der Spracherwerb im Vordergrund. Sie müssen Wörter korrekt, also klar und deutlich, verstehen, um sie nachsprechen zu können.

Kinder sollen toben! Maßnahmen zur Lärmreduktion kommen allen in der Kita zugute.
Sollen die Kinder deshalb nur noch leise oder draußen spielen? Letztere Option ist bei großer Hitze, starker UV-Belastung, an Regentagen oder im Winter oft eingeschränkt.
Eine Lärmampel misst den aktuellen Schalldruckpegel und zeigt ihn für Kinder leicht verständlich in einem Ampelsystem an. Sie muss jedoch pädagogisch gut eingeführt werden. Kinder können auf das rote Licht reagieren und dann leiser spielen – oder auch den Antrieb entwickeln, das rote Licht bewusst zum Leuchten zu bringen.
Neben solchen organisatorischen Lösungen setzen geeignete Maßnahmen zur Lärmreduktion aber schon vorher an – nämlich auf der baulichen Ebene.
Groß, hell, laut?
Moderne Kitas werden gerne in einem bestimmten Stil entworfen: große Flächen an Sichtbeton, große Fensterflächen. Beides sind harte und damit schallharte Oberflächen – das heißt, sie reflektieren den Schall zu einem großen Teil. Die Folge: Schallwellen und deren von Wänden, Decke und Boden reflektierte Echos bleiben lange im Raum. Jeder Raum hat eine individuelle Nachhallzeit; hier ist sie meist groß.
Man kann die Nachhallzeit berechnen. Oder eine fachkundige Person wie die Fachkraft für Arbeitssicherheit ermittelt sie mit einem geeigneten Messgerät.
Eine ideale Nachhallzeit lässt sich nicht pauschal nennen. Entscheidend sind Parameter wie Raumgröße, Deckenhöhe und Nutzungsart des Raumes, beispielsweise Speiseraum, Gruppenraum oder Bewegungsflur. Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.7 und im Speziellen die DIN 18041 legen anhand dieser Angaben Nachhallzeiten fest. Die Ansprüche sind unter anderem bei inklusiver Nutzung von Gruppenräumen etwas höher, da es noch mehr auf die Sprachverständlichkeit ankommt.
Bei Gruppenräumen sollten Nachhallzeiten je nach Raumgröße etwa bei 0,3 bis 0,5 Sekunden liegen. Messungen ergeben dagegen auch mal Werte deutlich größer als eine Sekunde – eine Atmosphäre wie in einer Kirche oder einer großen Halle.
Gut gedämpft

Akustikpaneele kommen in vielen Varianten. Sie dämpfen Lärm – in der Kita wie in anderen Arbeitsbereichen.
Ist die tatsächliche Nachhallzeit bekannt, lässt sich berechnen, ob und wie die Eigenschaften von Wänden und Decken zu ändern sind, um die Soll-Nachhallzeit nach DIN 18041 zu erreichen. Die Methode der Wahl ist dabei das Anbringen von schallabsorbierendem Material, so genannten Akustikpaneelen. Diese gibt es in den verschiedensten Formen, Größen und Varianten: als Einsätze in abgehängten Decken, Schaumstoffpaneele zum Aufkleben an Wänden und Decken oder als solide Paneele beispielsweise für Spielbereiche. Meist ist das Material allerdings weich.
Weil Kinder alles mit den Händen erkunden wollen, sollte bei der Auswahl auf geeignetes Material geachtet werden – und darauf, wie es sich zugriffsgeschützt anbringen lässt, schließlich soll es lange halten. Achtung: Das Material darf nicht verändert werden! Vor dem Überstreichen ist beispielsweise Rücksprache mit der Herstellungsfirma nötig.
Zusätzlich können auch kleinere Maßnahmen helfen:
- Filz- oder Silikongleiter unter Tischen und Stühlen reduzieren schabende Geräusche beim Verrücken der Möbel.
- Teppiche oder Filzmatten, insbesondere in Bauecken oder Spielzeugkisten, dämpfen den Schall beim Umfallen von Kinderbauten sowie beim Aufräumen.
- Wattierte Tischdecken oder Platzdeckchen helfen, den Lärm durch klapperndes Geschirr zu reduzieren.
- Radios müssen nicht durchgehend laufen.
- Fenster, die zur Straße gerichtet sind, sollten nur kurzzeitig geöffnet werden.
Technische und organisatorische Maßnahmen ergänzen einander. So zeigen auch eine räumliche Entzerrung, der Wechsel ruhiger und bewegter Zeiten im Tagesablauf oder das Vermeiden von Stoßzeiten oft deutliche Effekte. In der Kita nicht zu unterschätzen sind flankierende pädagogische Maßnahmen: Gesprächs- und Kommunikationsregeln, das Einführen von "Lärmdetektiven" oder verbindliche Signale, wenn es doch einmal zu laut wird.
Ohren frei – Achtsamkeit ist Trumpf
Keine gute Lösung ist es, sich sprichwörtlich die Ohren zuzuhalten. Gehörschutz – ob Kapselgehörschutz oder angepasste Otoplastiken – bekämpft nicht die eigentliche Ursache des Lärms. Zu bedenken ist auch, dass es in der Kita im Hinblick auf die Sprachverständlichkeit auf gutes Hören, Sprechen und Verstehen ankommt. Punktuell kann individueller Schutz dennoch eine sinnvolle Ergänzung für das Personal darstellen, beispielsweise wenn Kinder einzugewöhnen sind.
Sinnvoller ist es, Lärm, Hören und Achtsamkeit mit den Kindern zu thematisieren. Dabei kann zum Beispiel die Lärmampel zum Einsatz kommen. So lässt sich mit dem Thema Lärm auch bei den Kindern Gehör finden.
Von: Kathleen Bösing und Dr. Eberhard Munz