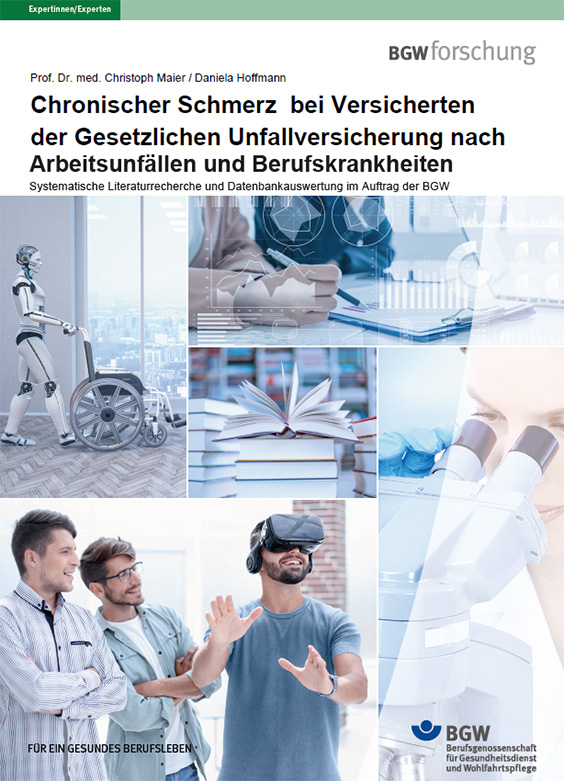Was tun, wenn der Schmerz bleibt? #130 BGW-Podcast "Herzschlag - Für ein gesundes Berufsleben"
Ziehen, stechen, brennen: Schmerz kennt viele Gesichter. Was aber, wenn er nicht mehr verschwindet? Wenn aus einem Warnsignal ein ständiger Begleiter wird? In dieser Folge sprechen wir über chronische Schmerzen und wie sie Körper, Psyche und Alltag beeinflussen können.
Zu Gast ist Dr. Mike Christian Zellnig, Chefarzt für Schmerzmedizin am BG Klinikum Duisburg. Er erklärt uns, was Schmerz eigentlich ist, ab wann man von chronischen Schmerzen spricht und welche individuellen Wege aus dem Schmerzkreislauf führen können.
Außerdem geben uns zwei Reha-Managerinnen der BGW praxisnahe Einblicke in das Schmerz-Assessment der BGW: die Schmerzsprechstunde und das Schmerzseminar. Eine betroffene Versicherte erzählt, wie ihr das BGW-Angebot nach einem Wegeunfall geholfen hat.
Hier kommen Sie zum Transkript dieser Folge
Moderator:
Dieses Geräusch kennen wahrscheinlich viele von euch. Wenn es irgendwo zieht oder zwickt, dann greift man schnell mal zur Schmerztablette. Was, wenn das auf Dauer nicht mehr reicht? Wenn Schmerzen nach einem Arbeitsunfall oder durch eine Berufskrankheit nicht mehr verschwinden, sogar zum ständigen Begleiter werden? Ein schmerzhafter Begleiter. Genau darum geht es in der heutigen Folge: Was genau sind Schmerzen oder chronische Schmerzen, und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Jingle:
Herzschlag! Für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.
Moderator:
Jeder Fünfte in Deutschland hat mehrmals die Woche oder sogar täglich körperliche Schmerzen. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage. Viele greifen dann zu Schmerzmitteln – klar, das hilft erstmal. Aber die eigentliche Ursache verschwindet dadurch nicht. Schmerz ist oft komplexer, als man denkt. Ja, der Schmerz – der kann Auswirkungen auf den Körper, auf die Psyche und das soziale Umfeld haben. Und wenn er chronisch wird, kann er extrem belastend sein. Dr. Mike Christian Zellnig, der kennt sich mit diesem Thema bestens aus. Er ist Chefarzt für Schmerzmedizin am BG Klinikum Duisburg. Grüß dich, Mike.
Mike Christian Zellnig:
Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung.
Moderator:
Mike, Hand aufs Herz: Wann hast du zum letzten Mal auf die Frage „Wie geht es dir?“ ehrlich geantwortet? Zum Beispiel so: „Ah, der Rücken, der macht Probleme, und das Knie schmerzt.“ Oder bleibst du so diplomatisch bei: „Alles gut“, und ignorierst das Ziehen in der Lendenwirbelsäule und vermeidest auch Gespräche über das Thema Schmerz?
Mike Christian Zellnig:
Hängt davon ab, wer fragt.
Moderator:
Ach so, ja, klar, ja.
Mike Christian Zellnig:
Bei manchen kann man vielleicht denken, dass eine ernste Antwort auf „Wie geht es dir?“ erwünscht ist. Bei manchen ist es vielleicht mehr eine Floskel.
Moderator:
Man sollte vielleicht nicht, wenn der Arzt fragt: „Wie geht es dir gerade?“ – „Oh, tut mir leid, ich bin gerade krank.“ Andere: „Ah, verdammt, ja, welche Tür hab ich da denn geöffnet?“
Mike Christian Zellnig:
Wie bin ich nur hier reingeraten? Nein, ich würde Schmerzen dann erwähnen in der Antwort, wenn sie für mich relevant sind. Ich treibe gerne Sport, und insofern: Irgendwas tut immer weh. Bin ja auch keine 30 mehr. Das würde ich aber nicht als Anlass nehmen, mich zu beklagen, dass mir was weh tut. Ganz im Gegenteil – zeigt ja, dass man noch lebt, dass man was getan hat, was ja auch gut tut. Und ich freu mich schon auf das nächste Match. Insofern konnotiere ich diesen Schmerz wahrscheinlich anders, wenn mir beim Aufstehen die Muskulatur weh tut, als wenn ich jetzt einen akuten Bandscheibenvorfall hätte und mich kaum bewegen könnte. Dann würde ich es eher erwähnen. Also: Hängt davon ab, welcher Schmerz.
Moderator:
Mike, wenn dich jetzt jemand fragt: Was ist Schmerz – wie erklärst du das? Das ist ja ein sehr subjektives Thema.
Mike Christian Zellnig:
Jetzt könnte ich wieder sagen: hängt davon ab. Wer fragt? Die einfache?
Moderator:
Also, der Podcast, das geht immer so weiter. Ja, es gibt.
Mike Christian Zellnig:
In Gegenfragen bin ich gut. Die einfache Antwort ist: Schmerz ist das, was jemand als Schmerz beschreibt. Schmerz kann körperlich sein. Schmerz kann sein: Ich hab Herzschmerzen bei irgendeinem Liebeskummer. Tatsächlich ist das auch eine Definition, die man relativ häufig findet: Schmerz ist das, was ein Patient als Schmerz beschreibt. Es gibt eine offizielle Definition von der Internationalen Schmerzgesellschaft, die ein bisschen technisch klingt, die aber eigentlich alles Relevante beinhaltet: „Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit tatsächlichem oder drohendem Gewebeschaden verknüpft ist oder mit Begriffen eines solchen beschrieben wird.“ Das muss man sich wahrscheinlich zweimal anhören und noch mal drüber nachdenken. Aber wenn man das auseinandernimmt: „Sinnes- und Gefühlserlebnis“ heißt, es ist beides. Ein Sinneserlebnis – also von den schmerzleitenden Nervenfasern ein auf körperlicher Ebene weitergeleitetes Erlebnis. Und ein Gefühl: Wir verknüpfen das auch immer mit etwas Emotionalem. Wenn wir Schmerzen haben, aber gerade abgelenkt sind, einen spannenden Film gucken oder es uns ansonsten gut geht, erleben wir Schmerzen, auch bevor sie chronisch werden, also schon akute Schmerzen – ganz, ganz anders und viel weniger beeinträchtigend, als wenn etwas anderes dazukommt. Also: Schmerzen werden immer körperlich und emotional empfunden. „Tatsächlicher und drohender Gewebeschaden“ – könnte man jetzt auch noch definieren. Ich muss mir ja kein Bein brechen, damit es weh tut. Es reicht, wenn ich irgendwo anstoße und die entsprechenden Rezeptoren melden, dass ich mir da eventuell etwas getan habe. Und der letzte Abschnitt: „Oder mit solchen Begriffen beschrieben wird.“ Na ja, wir hatten es gerade schon. Man kann Bauchschmerzen vor einer Entscheidung haben. Man kann Herzschmerzen bei Liebeskummer haben. Das heißt: Schmerzen beziehen sich auf den Körper, auch wenn Ursache und eigentlicher Kontext gar nicht unbedingt im körperlichen Bereich liegen.
Moderator:
Ab wann spricht man dann von chronischen Schmerzen?
Mike Christian Zellnig:
Das ist ’ne spannende Frage, weil man das durchaus unterschiedlich definieren kann. Früher hat man gesagt: Schmerzen, die länger als drei Monate dauern, sind chronische Schmerzen.
Moderator:
Und das ist ja auch schon echt wahnsinnig lange. Ich finde zwei Tage Schmerz ja schon unangenehm.
Mike Christian Zellnig:
Das stimmt allerdings. Wenn man, was man altersgemäß ja nun mal irgendwann entwickelt, eine Arthrose hat und es tut morgens beim Aufstehen oder nach längerer Bewegung weh, dann hat man das ja nun mal über längere Zeit. Ist somit per Definition nach Zeitdauer chronischer Schmerzpatient, geht aber vielleicht trotzdem arbeiten und Tennis spielen und ist dadurch gar nicht so sehr beeinträchtigt. Also sagt die reine Zeitdauer ja nicht unbedingt etwas aus. Wenn ich unsere Patientinnen und Patienten hier im BG Klinikum betrachte, die teilweise sehr schwere Unfälle haben, die lange vielleicht erst auf der Intensivstation lagen, mehrfach operiert wurden, dann bettlägerig sind und erst nach drei Monaten überhaupt erst mal richtig anfangen, wieder zu belasten, dann ist ja auch das eigentlich noch ein nachvollziehbarer und akuter Schmerz. Der Körper signalisiert: Du bist noch nicht wieder fit. Das als chronischen Schmerz zu bezeichnen, also vielleicht kann man die Begriffe unterscheiden, chronisch und chronifiziert, also verselbstständigter Schmerz – das wäre falsch. Insofern gibt es da eine neuere Definition: Chronische Schmerzen hat man dann, wenn sie über die erwartete Heilungszeit hinaus bestehen und darüber hinaus ihren wahren Charakter verloren haben. Also hätte man nach Zeitdauer chronische Schmerzen, wenn man eine altersbedingte, normale Verschleißarthrose hat und es morgens beim Aufstehen weh tut, aber der wahre Charakter ist ja eigentlich noch da. Das Gelenk sagt einem, wann es zu viel ist. Dann wäre man nicht in dem Sinne chronisch schmerzkrank. Das ist aber insofern spannend, als dass man Statistiken findet, wonach 20 bis 30 Prozent der deutschen Bevölkerung chronische Schmerzen haben. Wenn man aber schaut, wer tatsächlich behandlungsbedürftig ist wegen dieser Schmerzen und wer auch psychisch darunter leidet, dann ist das nur ein viel, viel kleinerer Anteil dieser eigentlich ja auf dem Papier sehr vielen Patientinnen und Patienten.
Moderator:
Daran sieht man halt auch: Das Thema Schmerz – das ist eben nicht nur in Schwarz und Weiß aufzuteilen. Das ist schon sehr individualisiert.
Mike Christian Zellnig:
Absolut. Wie gesagt: Schmerz ist das, was man als Schmerz empfindet. Es gibt Schmerzen, die kann man ganz ohne körperliche Schädigung haben, die trotzdem als Körperschmerz empfunden werden, also rein seelische Schmerzen, somatoforme Schmerzen, also körperähnliche Schmerzen. In den allermeisten Fällen ist das ein gewisses Mischbild aus körperlichen Aspekten und hinzukommenden psychosozialen Aspekten. Das hattest du auch in der Einleitung erwähnt. Aber ja, Schmerzen sind sehr subjektiv. Es gibt ganz spannende Erhebungen, die zeigen, dass Menschen, die beispielsweise sozioökonomisch besser gestellt sind, also in Berufen arbeiten mit mehr Freiheiten, mit mehr eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, bei gleicher Schmerzstärke – wenn man diese 0-bis-10-Skala zugrunde legt – Schmerzen viel weniger als limitierend empfinden als Menschen, die auch ansonsten in eher fremdbestimmten, einschränkenden Situationen stecken. Schmerzen sind subjektiv. Schmerzen sind abhängig von sozioökonomischen Faktoren, vom Kontrollempfinden, wie in diesem Beispiel hier. Und auch das hatten wir gerade schon kurz angesprochen: von psychischen Faktoren. Insofern sind Schmerzen sehr spannend und immer ein bunter Obstsalat aus allen Aspekten, die da so drinstecken.
Moderator:
Ja, man kann dann auch den Schmerz erlernen, beziehungsweise lernen, damit zu leben, vielleicht. Ein ganz plattes Beispiel, weil das ist ja nun auch nicht wirklich großer Schmerz, aber: Du gehst gerade von deiner Wiese zum Swimmingpool und bist dann da auf so heißen Platten, wo die Sonne drauf geballert hat. Am Anfang sagst du: „Au, au, au!“, das tut dir wahnsinnig weh. Beim zweiten Mal weißt du schon, das wird so ein bisschen heißer sein. Da hast du dich schon drauf eingestellt und gehst auch schon langsamer und gemächlicher dahin, weil du weißt, wie das Wasser auch temperiert ist. Also, man lernt halt irgendwann auch ganz schnell, mit bestimmten Schmerzen umzugehen.
Mike Christian Zellnig:
Ja, und der Körper wächst mit seinen Aufgaben. Ich nenne meinen Patientinnen und Patienten häufiger ein etwas anderes, aber sehr ähnliches Beispiel. Ich beschreibe, wie das ist, wenn man im Urlaub, jetzt zur Sommerzeit, barfuß am Strand läuft. Wenn man sonst immer mit Schuhen zu Hause herumläuft und das gar nicht gewohnt ist, barfuß zu gehen, dann tut jede Muschel, auf die man tritt, am Strand weh. Aber weil man das dann einen Urlaub lang macht, stört es einen irgendwann nicht mehr, genau wie bei den heißen Platten in deinem Beispiel. Das heißt, man gewöhnt sich an verschiedene Belastungen. Jetzt haben aber manche unserer Patientinnen und Patienten die Idee und sagen: Das tut weh, wenn ich das mache, also über den Strand oder über die heißen Platten laufe. Ich brauche erst eine Behandlung, die mir das ermöglicht, das schmerzfrei wieder zu tun. Und wenn dann alles gut ist, dann fange ich wieder an, über die heißen Platten oder den Strand zu laufen. Und das funktioniert oft nicht, weil der Weg auch durch das Gehen entsteht, also dadurch, dass man sich abhärtet, dadurch, dass man wieder vom Sofa runterkommt und sich den Reizen aussetzt. In dem Moment werden auch die Schmerzen durch die Reize wieder geringer.
Moderator:
Du hast doch eben erwähnt, dass Schmerz nicht immer nur körperlich sein muss. Schmerz betrifft halt einfach auch noch andere Bereiche, er ist psychisch und auch sozial relevant. Kannst du erklären, was das in der Praxis heißt?
Mike Christian Zellnig:
Kann ich an einem Beispiel erklären. Es gibt ja das biopsychosoziale Modell der Schmerzentstehung, das sich genau aus diesen drei Aspekten zusammensetzt. Fangen wir beim biologischen mal an: Wir haben Patientinnen und Patienten, die häufig in körperlich anstrengenden Berufen tätig sind und auch eher körperliche Hobbys haben. Nehmen wir einen Patienten, der als Bauhelfer arbeitet und nebenbei noch in einer Altherren-Hobbymannschaft Fußball spielt. Jetzt erleidet er einen Sprunggelenksbruch. Dann sagt ihm der Durchgangsarzt schon: „Puh, so wie vorher wird das aber nicht mehr werden. Das mit dem Fußball kannst du dir wahrscheinlich abschminken. Und ob das beruflich noch mal was wird, mit schweren Geräten, Steinen und Säcken schleppen, das steht auch in den Sternen.“ Jetzt sitzt dieser Mann mit seinem Sprunggelenksbruch in der halbwegs akuten Phase, innerhalb der ersten Wochen, zu Hause auf dem Sofa. Und was passiert, wenn man auf dem Sofa sitzt? Der Kühlschrank ist in der Nähe. Die übliche körperliche Betätigung, die ja auch viele Kalorien verbrennt, fehlt. Also nimmt man zu. Dann geht man irgendwann mal an Unterarmgehstützen zum Fußballplatz, wo die anderen spielen, und schaut zu. Aber man ist frustriert, weil der Arzt gesagt hat, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Man verbreitet vielleicht etwas schlechte Laune. Die Fußballkollegen fragen ein- oder zweimal, ob man wiederkommt, aber eigentlich will man selbst gar nicht so richtig. Und irgendwann fragen sie dann auch nicht mehr, weil man immer so ein Miesepeter ist. Also sitzt man wieder auf dem Sofa, hat zugenommen, und es fehlt die soziale Einbindung. Was passiert? Die Laune wird schlechter, das Selbstvertrauen nimmt ab, die Stimmung wird depressiv. Dann kommt noch die familiäre Ebene dazu: Man pflaumt vielleicht auch zu Hause herum, salopp gesagt, und hat zusätzlich noch Sorgen, weil zum Beispiel die Wohnung abbezahlt werden muss, die Kinder im Studium sind und die berufliche Zukunft unklar ist. Da sieht man an einem relativ alltäglichen Beispiel ganz gut, wie schnell man in einen Teufelskreis geraten kann: körperliche Einschränkung, Gewichtszunahme, depressive Stimmung, soziale Isolation, wirtschaftliche Unsicherheit. Und dabei wäre das Sprunggelenk mit etwas Bewegung, mit Training, mit Gewichtsabnahme vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn man einmal richtig im Sumpf steckt und auf dem Sofa gefangen ist, aus Depression, aus körperlicher Einschränkung, aus sozialem Rückzug, dann wird’s richtig schwer. Genau deshalb setzt moderne Schmerztherapie auch dort an. Sie berücksichtigt all diese Aspekte – körperlich, psychisch, sozial – und führt Schritt für Schritt wieder in die Aktivität. Und nicht nur über Medikamente.
Moderator:
Alles sehr nachvollziehbar. Ich notiere mir trotzdem mal eben: abends auf dem Sofa weniger Käsecracker und Schokolade.
Mike Christian Zellnig:
Gute Idee!
Moderator:
Was sind die Klassiker unter den Schmerzen, mit denen deine Patientinnen und Patienten nach einem Arbeitsunfall oder wegen einer Berufskrankheit zu dir kommen?
Mike Christian Zellnig:
Schon das, was ich gerade gesagt habe, also Wegeunfälle oder Arbeitsunfälle. Arbeitsunfälle betreffen häufig die, die auch körperlich arbeiten, also schon vieles aus dem Baugewerbe oder ansonsten eben Verkehrsunfälle bei den Wegeunfällen. Wir haben sehr, sehr häufig verletzte Extremitäten, also Schmerzen nach Brüchen, nach Verletzungen von Armen, von Beinen. Häufig sind chronisch die Schmerzen, die aus einer Kombination bestehen, also ein Knochenbruch mit Schädigung eines Gelenks, wozu es dann zu der gerade genannten Arthrose kommt, oder Schädigung auch eines Nervs, was dann zu speziellen Nervenschmerzen führt. Nervenschmerzen sind deshalb spannend, weil sie eben nicht durch die normalen Gewebeschäden entstehen, sondern durch direkte Schädigung der Nerven und dann auch anders behandelt werden. Das heißt, Nervenschmerzen sprechen beispielsweise auf das übliche Ibuprofen, das wir am Anfang hatten und im Blister gehört haben, nicht an. Da muss man andere Medikamente nehmen. Deshalb ist auch die Unterscheidung spannend.
Moderator:
Auf jeden Fall kommen dann schon die Tramal Tropfen dazu.
Mike Christian Zellnig:
Ja, die sind auch keine gute Idee auf Dauer. Die helfen akut, aber tatsächlich: Nervenschmerzen, Extremitätenverletzungen, Rückenschmerzen – in unserem Fall in der Unfallklinik dann eben häufig nach Unfällen, nach Verletzungen. Es gibt noch den Bereich der Berufskrankheiten. Da nähern wir uns dann wieder der freien Wildbahn Schmerzmedizin sozusagen an. Das sind dann auch eben solche Bandscheibenbeschwerden, wie man sie in Nicht-Unfallkliniken in der Schmerzmedizin auch sieht.
Moderator:
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es darüber hinaus?
Mike Christian Zellnig:
Es gibt die Möglichkeit, ja möglichst ohne Medikamente zu behandeln. Es gibt sehr viele örtliche Behandlungsmöglichkeiten, die zum Teil ganz interessant sind. Also, es gibt ein Pflaster, das den Wirkstoff der Chilischote enthält – das, was Chili scharf macht: Capsaicin. Das dockt an bestimmten Nervenendigungen an und bringt die Nerven dazu, sich für eine Zeit lang fast abzuschalten, sodass man bei Nervenschmerzen deutlich weniger Probleme hat. Es gibt die Möglichkeit, Botox – das, was man gegen Falten spritzen kann – auch an Nerven oder in ein bestimmtes, von den geschädigten Nerven betroffenes Hautareal zu spritzen, was ebenfalls Schmerzen lindert. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, insbesondere durch Physio-, durch Ergotherapie, durch das, was wir gerade gesagt haben – also auch in Bewegung kommen. Es gibt psychologische Behandlungsverfahren, beispielsweise Entspannungsverfahren oder auch Hypnosetherapie, Hypnotherapie. Es gibt elektrische Behandlungsmöglichkeiten mit TENS-Geräten, die man zum Teil kennt, aber auch mit implantierbaren Nervenstimulatoren. Es gibt Stoßwellenbehandlungen und es gibt die Kombination von allen Verfahren: die interdisziplinäre, multimodale, stationäre Schmerztherapie, bei der wirklich verschiedene Fachrichtungen und Professionen – Psychologen, Therapeuten, Ärzte – in diesem Zusammenspiel das individuell Passende für die Schmerzen und das jeweilige Problem heraussuchen. Und natürlich gibt es naturheilkundliche Möglichkeiten, die auch zum Teil sehr evidenznah eingesetzt werden können.
Moderator:
Das sind ja schon sehr viele Möglichkeiten. Das macht dann ja auch Hoffnung, wenn man betroffen ist. Auf jeden Fall. Wie sehr spielt auch der Kopf mit, also wie groß ist der Einfluss von Dingen wie Erwartungen, Einstellung oder auch Placeboeffekten?
Mike Christian Zellnig:
Absolute Vorbedingung: Wenn man der Überzeugung ist, dass etwas nicht helfen wird – beispielsweise wenn man gegen Medikamente eingestellt ist – dann werden diese Medikamente zu Nebenwirkungen führen, dann werden diese Medikamente nichts bewirken. Das ist das Gegenteil vom Placeboeffekt, der böse Bruder vom Placeboeffekt sozusagen: der Noceboeffekt. Also die negative Erwartungshaltung bedingt auch einen negativen Erfolg. Das konnte man in Studien sehr eindrucksvoll zeigen: Wenn Versuchspersonen ein Schmerzmittel bekommen, dann sprechen sie in gewissem Maße verbessert auf Hitzeschmerzreize an. Die Vorbehandlung mit einem Medikament, ohne zu wissen, dass man es bekommt, reduziert das Empfinden bei Schmerzreizen. Wenn man das gleichzeitig kommuniziert, also sagt: „Du bekommst jetzt ein Medikament vor dem nächsten Schmerzreiz“, dann wirkt es doppelt so gut. Der Placeboeffekt – die positive Erwartung – verdoppelt also den Effekt. Das Medikament allein wirkt ohne Erwartung weniger. Wenn man im Umkehrschluss das Medikament aber gibt und negativ kommuniziert, zum Beispiel: „Du bekommst jetzt kein Medikament, das dir hilft“, dann macht das jeden Effekt, der vorher vom Medikament selbst noch da war, zunichte. Wir sehen daran: Wenn man vom Kopf her, von der Überzeugung, dass eine Behandlung für mich die richtige ist, nicht überzeugt ist, dann wird mir diese Behandlung in keinem Fall helfen.
Moderator:
Das haben wir auch schon öfter gehört hier beim Herzschlag-Podcast: wie man eben auch an sich schon glauben muss und auch Dinge annehmen sollte. Warum tun wir oft nicht das, was uns gut tut – trotzdem, gerade bei Schmerzen? Was sagt da die Verhaltensökonomie dazu?
Mike Christian Zellnig:
Die Verhaltensökonomie sagt, dass wir einmal den Intention-Behavior-Gap haben, also das, was wir uns vornehmen, und das, was wir tatsächlich machen. Da müssen wir erst einmal Energie aufwenden, um das auch wirklich zu tun.
Moderator:
Ich unterstreiche noch mal die Käsecracker hier.
Mike Christian Zellnig:
Ja, ja, genau. Wenn wir uns vornehmen, in der Kantine heute wirklich den Salat zu essen, und dann lacht uns das Schnitzel an, dann sind die Intentionen dahin. Aber na ja, gut, komm, nur heute noch das Schnitzel – aber ab morgen wirklich der Salat. Das nennt sich Present-Bias, also die Gegenwartsverzerrung. Wir verschieben unangenehme Dinge in die Zukunft. Deswegen rauchen Raucher und denken: Ich hör schon noch auf, bevor es mir wirklich schadet und bevor ich dann Lungenkrebs bekomme – und schieben das so von Tag zu Tag. Das heißt, wir überbewerten die Gegenwart unter Vernachlässigung der Zukunft. Und das ist einer der möglichen Effekte. Es gibt andere. Der Status-quo-Bias heißt, dass man einen gegenwärtigen Zustand immer einer Veränderung vorzieht. Wir haben Angst vor Veränderungen. Bei unseren Patientinnen und Patienten stellen wir zum Teil fest, dass sie sich erheblich schlechter stellen, wenn sie in der Verletztengeldzahlung über die Berufsgenossenschaft sind. Die Arbeitsfähigkeit, das wieder aus eigener Kraft, mit Entlohnung, „Brot und Arbeit“, zu stehen, wäre viel vorteilhafter, aber natürlich birgt es diesen Unsicherheitsfaktor: Schaffe ich das? Bin ich den Aufgaben wieder gewachsen? Was bleibt da an Folgen übrig? Und das macht eine gewisse Scheu vor Veränderung. Das ist ganz normales menschliches Verhalten – das haben wir alle. Führt aber dazu, dass wir Dinge unbewusst zum Teil hinausschieben oder in der Gegenwart, auch wenn es eigentlich wichtig wäre, nicht ausreichend berücksichtigen.
Moderator:
2023 wurden über 200.000.000 Schmerzmittelpackungen verkauft, also vor allem Ibuprofen, Paracetamol, ASS. Was sagt das über unseren Umgang mit Schmerzen aus? Also werfen wir die Dinger vielleicht viel zu viel ein, schon bei einer Kleinigkeit? Und wie oft sollte ich überhaupt Schmerzmittel nehmen? Ab wann sind sie ein Risiko?
Mike Christian Zellnig:
Kommt drauf an, wann man sie nimmt, welche man nimmt und wofür man sie nimmt. Wenn man Schmerzmittel nimmt, weil man mal Kopfschmerzen hat oder weil einem mal was weh tut, weil man sich irgendwie den Rücken verdreht hat, dann ist es gut, die zu nehmen. Und es hilft, in Bewegung zu kommen oder in Bewegung zu bleiben. Das soll man ja gerade eben machen – auch bei ganz akuten Rückenschmerzen, wenn da nichts Schlimmes passiert ist, man keinen Bandscheibenvorfall hat. Dann soll man schon durchaus mit den handelsüblichen Rückenschmerzen auch weiter in Bewegung bleiben. Wenn man aber Medikamente nimmt, immer wieder und immer wieder, ohne an der Ursache etwas zu beheben, dann macht es natürlich keinen Sinn. Dann können Medikamente wie Ibuprofen oder Diclofenac oder Paracetamol auch Schäden machen – an der Leber, an der Niere, am Magen-Darm-Trakt. Generell gilt, dass man nicht nur symptomatisch behandelt. Man kann Schmerzen als Symptom mal eine Zeit lang unterdrücken. Wenn es aber nur die symptomatische Behandlung ist – das ist ja etwas, was man Schmerzmedizinern häufig vorwirft: Wenn man da hingeht, kriegt man nur irgendwelche Medikamente verschrieben, interessiert sich keiner für die Ursache, man wird wieder weggeschickt – das ist eigentlich in der modernen Schmerzmedizin nicht mehr der Fall. Sondern Schmerzmedizin ist auch Ursachensuche. Der Versuch, unter vielleicht einer Überbrückung mit Medikamenten, auch an der Ursache zu arbeiten. Womit wir wieder bei der Bewegung wären – also das Auftrainieren der Rückenmuskulatur, die verhindert, dass man wieder solche Probleme bekommt bei falschen Bewegungen. Das ist dann oft der lange und steinige Weg, weil man trainieren muss, und das tut ja am Anfang sogar erst mal mehr weh. Aber es ist trotzdem der richtige Weg. Insofern: 200.000.000 Schmerzmittelpackungen – wahrscheinlich ein Großteil davon wird nicht sinnvoll eingenommen, ein anderer Teil bei akuten Beschwerden aber völlig okay.
Moderator:
Cannabis ist seit ein paar Jahren wieder ein sehr politisch großes Thema – natürlich auch in der Schmerzmedizin. Welche Erfahrung hast du damit gemacht? Und kann man vielleicht auch sagen: Ah, es ist hier ein bisschen schmerzhaft, vielleicht abends so ein bisschen den Schmerz „wegmampfen“ mit ein paar Haschkeksen?
Mike Christian Zellnig:
Ja, klingt super. Nun, insbesondere weil das dann ja etwas Natürliches ist – so in der Empfindung. Die Schmerzmittel werden ja als etwas Chemisches und potenziell Schädliches empfunden, das Cannabis hingegen nicht. Meine Sorge ist, dass da häufig falsche Erwartungen bestehen. Diese Idee, Cannabis als das grüne Gold, das auf natürliche Weise und schmerzmindernd wirkt, die zeigt sich in der Forschung nicht. Also: Die spezifische Wirkung gegen Schmerzen ist gar nicht so gut. Gegen chronische neuropathische Schmerzen, also Nervenschmerzen, hat es eine gewisse Wirkung, die aber hinter denen von Medikamenten oder örtlichen Verfahren, die ich schon genannt habe, durchaus zurücksteht. Insofern ist das nirgendwo erste Wahl. Was Cannabis aber macht – je nachdem, welche Inhaltsstoffe drin sind, gerade das THC, also die berauschende Substanz – ist, ein gewisses Wohlbefinden und einen gewissen Rausch zu erzeugen. Und dass das auf indirekte Weise auch Schmerzen lindert, weil es einem vielleicht egaler ist, weil man sich insgesamt besser fühlt, weil man vielleicht sogar ein bisschen berauscht ist – das funktioniert schon und wird von Menschen, die Cannabis dann nehmen, in welcher Form auch immer, oft auch positiv empfunden. Es ist aber keine spezifische Schmerzlinderung und birgt natürlich auch weitere Gefahren. Ich sage manchmal salopp zu Patientinnen und Patienten, die danach fragen: Na ja, in manchen Fällen wäre das so, als ob Sie eine Flasche Weißwein abends trinken. Kurzfristig ist das irgendwie ganz entspannt, man fühlt sich gut und schläft besser – aber es ist auch nicht wirklich eine langfristige Lösung zur Behandlung der Schmerzen, weil man sich andere Probleme damit einfängt. Und das ist beim Cannabis schon auch so. Es kann die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen, es kann eine Abhängigkeit zur Folge haben, gerade bei den inhalativen Formen. Also nicht die Kekse, die du genannt hast, sondern der Joint – das sind meistens keine gute Idee.
Moderator:
Ich habe auch schon gelernt, ja. Also die Tramal Tropfen nicht mehr auf die Käsecracker, dann hat man schon mal viel erreicht irgendwie.
Mike Christian Zellnig:
Auf die Spacekekse. Tramal Tropfen auf die Spacekekse.
Moderator:
Genau, aber du hast es ja vorhin auch schon sehr deutlich erwähnt: Bewegung ist sehr wichtig, und das sagt auch die European Pain Federation. Bewegung ist das A und O bei chronischen Schmerzen. Da muss man sich dann auch erst einmal hintrainieren, den inneren Schweinehund bewegen, runter vom Sofa kommen – hast du vorhin gesagt – und dann hat man auch schon viel erreicht. Vielen Dank für diese sehr schmerzhaften Informationen, die sehr wichtig sind. Danke, Mike Zellnig.
Mike Christian Zellnig:
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank – und es tut mir leid, dir die Käsecracker madig gemacht zu haben.
Moderator:
Ihr habt gehört, wie komplex Schmerz sein kann, welche Auswirkungen er auf den Körper, die Psyche und auch das soziale Umfeld haben kann. Was passiert, wenn der Schmerz bleibt, wenn man raus will, jedoch nicht weiß, wie – bei beruflich bedingtem Schmerz? Genau hier kommt das Reha-Management ins Spiel. Die BGW bietet je nach Standort verschiedene Angebote an: eine Schmerzsprechstunde oder auch ein Schmerzseminar. Wo hier genau die Unterschiede liegen und wie das Ganze abläuft, das lasse ich mir jetzt mal von zwei Reha-Managerinnen der BGW erklären. Ich starte mit Samara Reiß, die in der Bezirksverwaltung Karlsruhe arbeitet. Grüß dich, Samara.
Samara Reiß:
Hi Ralf, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Moderator:
Die Schmerz-Samara ist bei mir. Was versteht man unter Reha-Management, und was genau machst du als Reha-Managerin?
Samara Reiß:
Schöne Frage zum Einstieg. Also: Reha-Management ist im Prinzip die umfassende Planung und Koordination von Maßnahmen der medizinischen Reha, von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, aber auch von der sozialen Teilhabe. Und wir im Reha-Management arbeiten quasi im Außendienst. Wir sind persönliche Ansprechpartner, also betreuen die Versicherten persönlich vor Ort, beraten sie – genau. Das sind insbesondere Fälle, die einfach gerade im Arbeitsunfallbereich komplexer sind, wo es zum Beispiel auch Komplikationen im Heilverfahren gibt. Zum Beispiel Wundheilungsstörungen, Knochenheilstörungen oder eben auch das Thema Schmerz. Und genau, wir sind dann vor Ort, koordinieren gemeinsam mit den Ärzten, mit den Versicherten, mit Angehörigen, mit beteiligten Therapeutinnen und Therapeuten das weitere Verfahren, planen das Ganze, erstellen die AU-Reha- und Teilhabepläne, die der Versicherte dann an die Hand bekommt, damit er eben auch Bescheid weiß: Okay, wie geht es weiter? Ja, genau – das ist so ein bisschen unsere Aufgabe.
Moderator:
Und natürlich heißt es bei dir in Karlsruhe Außendienst, ne? Da muss man jetzt lokal natürlich auch unterstreichen.
Samara Reiß:
Genau.
Moderator:
Wie sieht es denn da genau vor Ort aus? Also, da gibt es die Möglichkeit, auch ein Schmerzseminar zu machen, daran teilzunehmen in Karlsruhe. Aber was genau muss ich mir darunter jetzt vorstellen? Wie läuft dieses Schmerzseminar ab?
Samara Reiß:
Also, wir haben bei uns am Standort in Karlsruhe eben dieses Schmerzseminar. Das findet bei uns im Haus, im Schulungs- und Beratungszentrum, quasi an zwei Tagen statt. Am ersten Tag gibt es zwei Vorträge: einmal von der Psychologin und einmal von einem Facharzt. Und am zweiten Tag gibt es dann Zirkelgespräche mit dem Facharzt, mit der Psychologin, mit einem Physiotherapeuten und mit jemandem von uns aus dem Reha-Management. Wir haben da auch genügend Zeit – das ist tatsächlich auch das Positive, was wir zurückgespiegelt bekommen: dass die einzelnen Beteiligten sich wirklich Zeit nehmen für die Versicherten und es eben nicht so ist, wie es oftmals in der Praxis läuft – so nach dem Motto: fünf Minuten rein und wieder raus. Jeder spricht dann quasi seine Empfehlungen aus. Also, wir Beteiligten setzen uns zum Schluss alle noch einmal zusammen, jeder sagt: „Okay, was würde er empfehlen, wie soll das weitere Vorgehen sein?“ Dann bekommt der Versicherte das Ganze mündlich noch einmal mitgeteilt, bekommt es aber auch schriftlich an die Hand. Und im Prinzip fragt dann entweder der Sachbearbeiter oder der Reha-Manager nach einer bestimmten Zeit auch noch einmal nach: Wie wurden die Maßnahmen umgesetzt? Wo kann man gegebenenfalls noch einmal unterstützen?
Moderator:
Das ist also schon eine individuelle Schmerztherapie. Man fängt schon an, das genau zu ermitteln, zu erkunden.
Samara Reiß:
Genau. Also der einzelne Versicherte steht im Fokus und bekommt eben auch individuelle Empfehlungen ausgesprochen. Dadurch, dass sich jeder bei den einzelnen Fachdisziplinen dann quasi vorstellt und es gemeinsame Gespräche gibt, kann eben jeder Einzelne auf die versicherte Person eingehen und entsprechende Empfehlungen aussprechen.
Moderator:
Muss man da bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um teilnehmen zu können? Also, gibt es vorab vielleicht auch einen Schmerzcheck? So nach dem Motto: Nee, bei dir ist der Schmerz noch nicht ganz so doll, komm mal nächstes Jahr wieder?
Samara Reiß:
Ja, also tatsächlich. Zum einen ist es so, dass eine anerkannte Berufskrankheit vorliegen muss oder eben der Arbeitsunfall schon geprüft und bejaht sein muss. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass es so eine Art Check gibt. Also, wenn wir im Reha-Management zum Beispiel in den Fällen noch gar nicht involviert sind, hat der Sachbearbeiter das im Blick, guckt sich entsprechend die Berichte an. Es gibt eben auch Checks in Form von Fragebögen, die rausgeschickt werden können, um das Ganze einzuschätzen. Man ist ja dann auch telefonisch mit den Versicherten in Kontakt, wo man dann nachfragen kann: Okay, habe jetzt im Bericht gelesen, da stand etwas von Schmerz – wie ist der Schmerz? Was nimmst du vielleicht auch für Medikamente? Genau, also da hat der Sachbearbeiter schon einen Blick drauf. Und dann werden wir im Reha-Management eben mit dazu gezogen. Wir kriegen da quasi eine Vorlage: Versicherter fürs Schmerzseminar – würde das passen? Und wir gucken uns das Ganze dann noch einmal an, sprechen gegebenenfalls auch noch einmal mit dem einzelnen Versicherten und schauen dann: Okay, ist das tatsächlich jemand, für den das Seminar passt?
Moderator:
An wen wende ich mich jetzt als Versicherter, Betroffener oder versicherte Betroffene?
Samara Reiß:
Also am besten im Prinzip an den Sachbearbeiter. Wenn wir als Reha-Manager schon involviert sind – das kann in manchen Fällen durchaus sein – dann gern auch direkt an den Reha-Manager wenden. Ansonsten hat jeder Versicherte einen entsprechenden Ansprechpartner, einen Sachbearbeiter, an den man sich da auch gerne wenden kann.
Moderator:
Danke, Samara, für deinen Einblick ins Reha-Management und das Schmerzseminar der BGW.
Samara Reiß:
Sehr gerne.
Moderator:
Von Karlsruhe geht es jetzt nach Berlin zu Claudia Pruß, ebenfalls Reha-Managerin bei der BGW. Hallo, Claudia.
Claudia Pruß:
Ja, hallo Ralf, Gruß aus Berlin.
Moderator:
Bei euch sieht das Schmerz-Assessment etwas anders aus. Ihr bietet eine Schmerzsprechstunde an. Was ist das genau?
Claudia Pruß:
Ja, das ist im Vergleich zu Karlsruhe komprimierter und tatsächlich nur auf zweieinhalb Stunden pro Teilnehmer angelegt. Das ist ein Gespräch mit einem Schmerztherapeuten für eine Stunde, dann eine psychotherapeutische Gesprächsrunde für eine Stunde – jeder individuell, jeder einzeln und dann kommen wir danach zusammen mit der Reha-Managerin. In der Regel bin ich das, und wir werten das Ganze aus.
Moderator:
Kann man ja sagen: Moment mal, in Karlsruhe, da geht man ja wirklich irgendwo richtig hin zum Arzt, zur Ärztin und hier zweieinhalb Stunden? Reicht denn das, Claudia?
Claudia Pruß:
Das reicht auf jeden Fall. Also, man kommt, man lädt den Versicherten in unsere Verwaltung ein, sie sprechen mit dem Arzt – das ist also wirklich sehr individuell – und wird von den Leuten sehr begrüßt, weil man sich einfach die Zeit nimmt und sie sich wirklich aufgehoben fühlen. Sie können in dieser einen Stunde eigentlich mal das sagen und besprechen, was sie sonst tatsächlich nie so ausführlich sagen können. Und sie werden dann eben auch entsprechend ausführlich beraten, was in der tatsächlichen Praxis so nicht möglich ist.
Moderator:
Und gibt’s da ansonsten noch Unterschiede? Sprechstunde und Schmerzseminar?
Claudia Pruß:
Ja, tatsächlich ist es überhaupt kein fachlicher Vortrag. Das, was die Samara vorher gesagt hat, dass sie an einem Tag Vorträge halten, das machen wir nicht. Sondern wir gehen genau zielgerichtet nur auf den einzelnen Menschen ein, und es wird auch nichts Theoretisches vermittelt, sondern wirklich praktisch angesetzt bei den Beschwerden, die derjenige vorträgt.
Moderator:
Gelten bei euch die gleichen Teilnahmevoraussetzungen wie in Karlsruhe?
Claudia Pruß:
Ja, wir schauen sowohl in der Sachbearbeitung als auch im Reha-Management, wenn die Beschwerden in der Akte sozusagen auftauchen oder jemand im Gespräch äußert, er hat starke Schmerzen, akut oder auch gegebenenfalls chronisch, dann erfolgt die Einladung. Wir erheben auch den Schmerz in einem Screening-Fragebogen, und grundsätzlich wird dann noch einmal abgefragt, ob Interesse besteht, und dann erfolgt die Einladung.
Moderator:
Und Claudia, erinnerst du einen Schmerz von einem Patienten oder einer Patientin, der besonders hängengeblieben ist und behandelt werden konnte?
Claudia Pruß:
Tatsächlich hatten wir letzte Woche gerade eine Schmerzsprechstunde, und da ist es so, dass eine sehr schmerzgeplagte Dame eingeladen wurde. Wir konnten dann sofort zeitnah, und das ist eigentlich unser großer Vorteil, mit dem Schmerztherapeuten, der auch Chefarzt im Unfallkrankenhaus ist, sozusagen aus der Schmerzsprechstunde heraus eine Schmerz-Reha-Maßnahme, eine stationäre, generieren, die dann eigentlich drei Tage später angefangen hat. Das heißt, wir sind in dieser Schmerzsprechstunde sehr schnell, wir intervenieren sofort, wenn es nötig ist, und das ist auch ein ganz großer Vorteil für die Versicherten, die da kommen. Denn sie bekommen eine Kostenübernahme für eine Psychotherapie mit oder eben gleich tatsächlich eine Reha verordnet, in Anführungsstrichen, die sie dann auch wirklich zeitnah beginnen können.
Moderator:
Ja, sonst muss man ja ewig auf so etwas warten. Monate, meistens ein halbes Jahr.
Claudia Pruß:
Genau, das ist eben unser großer Vorteil, dass wir die Protagonisten, die in Berlin auch führend sind, sozusagen in dieser Schmerzsprechstunde haben und dann gleich agieren können.
Moderator:
Und was war das für ein Schmerz? Was hatte die Patientin?
Claudia Pruß:
Die hatte eine Beinverletzung und war sehr eingeschränkt, wollte aber unbedingt in die Arbeit zurück. Sie hatte auch den Druck, dass der Arbeitgeber sie braucht, und sie wollte selbst auch unbedingt wieder arbeiten. Ambulant ging es aber überhaupt nicht voran, und man hat ihre Bedürfnisse sozusagen gar nicht gesehen. Daraufhin haben wir in Zusammenarbeit diese Schmerz-Reha eingeleitet und erhoffen uns davon eine zügige Heilung.
Moderator:
Vielen Dank, Claudia, für den kurzen Überblick zur Schmerzsprechstunde der BGW und liebe Grüße nach Berlin.
Claudia Pruß:
Ja, vielen Dank, Ralf. Schönen Tag noch, tschüss.
Moderator:
Das war die Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus? Was sagen Menschen, die am Schmerz-Assessment teilgenommen haben? Eine Teilnehmerin verrät uns jetzt, wie ihr das Schmerzseminar geholfen hat. Bei mir ist Isabel Scherle. Hallo, was ist dir passiert? Warum hast du dauerhafte Schmerzen?
Isabel Scherle:
Ich hatte vor knapp zwei Jahren einen Fahrradsturz auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe mir dabei blöd mein Handgelenk verletzt. Daraufhin hatte ich zwei Operationen. Und durch die Verletzung, durch den Sturz oder durch die OP hat sich dann eine Schmerzerkrankung entwickelt. Die nennt man CRPS, also komplexes regionales Schmerzsyndrom. Und genau dadurch habe ich immer noch mit Einschränkungen und Schmerzen zu kämpfen.
Moderator:
Wie ist dieser Fahrunfall passiert?
Isabel Scherle:
Ich bin beim Abbiegen in der Straßenbahnschiene hängengeblieben.
Moderator:
Woah! Es ist ja fast allen schon mal passiert. Verdammt, ja, da muss man aufpassen.
Isabel Scherle:
Passiert häufig. Ja, ja.
Moderator:
Ich bin auch schon zweimal dadurch hingefallen. Aber ja, die Schmerzen waren von kurzer Dauer. Tatsächlich ist es so, dass das jetzt geblieben ist, irgendwas ist da halt los. Kannst du die Schmerzen beschreiben? Tut es dauerhaft weh, bei bestimmten Bewegungen? Was ist da mit deiner Hand?
Isabel Scherle:
Jetzt aktuell ist es so, dass ich keine dauerhaften Schmerzen mehr habe. Das hat sich zum Glück schon ein bisschen ins Positive entwickelt. Ich habe hauptsächlich eine Bewegungseinschränkung, bei der meine Hand bei der Drehbewegung an einem bestimmten Punkt stoppt, und dann kommt ein stechender Schmerz. Das ist das eine. Das andere ist: Sobald ich die Hand ein bisschen länger oder stärker belaste, kommt einfach ein Schmerz im Handgelenkbereich, Handrücken, teilweise auch ein bisschen in den Fingern. Und das dauert dann manchmal ein paar Stunden, bis der wieder weggeht. Mal dauert es länger, mal kürzer, und das kommt dann immer mal wieder – je nachdem, wie ich sie eben belaste.
Moderator:
Jetzt hast du am Schmerzseminar teilgenommen. Warum hast du das gemacht? Hast du keinen anderen Ausweg mehr gesehen? Wie hast du davon erfahren?
Isabel Scherle:
Das Schmerzseminar wurde mir von der BGW angeboten, von meiner BG-Managerin, und ich war eher an dem Punkt, wo ich alle Möglichkeiten und neuen Ansätze, die es gibt, einfach nutzen wollte. Weil ich zwischenzeitlich schon ein bisschen frustriert war von meiner Situation. Und dann dachte ich so: Ja, probiere ich das mal aus. Und dann habe ich letztes Jahr im November am Schmerzseminar in Karlsruhe teilgenommen.
Moderator:
Was hat dir da besonders geholfen?
Isabel Scherle:
Also zuallererst fand ich es sehr gut, dass uns zuerst Hintergrundwissen im medizinischen und psychologischen Bereich zum Thema Schmerzen mitgegeben wurde. Und es war auch so das erste Mal, dass ich mich theoretisch mit dem Thema chronische Schmerzen befasst habe. Das war erstmal für mich ganz hilfreich. Wir waren außerdem eine relativ kleine Gruppe von fünf Betroffenen, und dadurch hat sich ein ganz schöner, geschützter Rahmen für den persönlichen Austausch ergeben. Es hat mir einfach geholfen, auch mal mit anderen Betroffenen darüber zu sprechen, was sie für Strategien und Tipps im Umgang damit haben. Was auch noch echt gut und hilfreich war: Am zweiten Tag des Seminars gab es eine individuelle Beratung für jede und jeden. Da haben ein Arzt, eine Psychologin, ein Physiotherapeut und eine BG-Managerin noch einmal bei mir auf meine Hand geschaut, um zu gucken, wie es weitergehen kann. Gibt es noch andere Ideen? Gibt es noch Dinge, die ich in den Therapien oder auch privat ausprobieren kann? Und da bin ich dann auch mit ein bisschen mehr Hoffnung aus dem Seminar rausgegangen, weil ich einfach so einen schriftlichen Zettel in der Hand hatte, auf dem neue Ansätze und Ideen standen, die ich dann ausprobieren konnte.
Moderator:
Schöne, vertrauliche Atmosphäre, und es gibt gute neue Tipps und ein gutes Gefühl. Das macht ja auch schon ganz viel aus. Und gab es auch guten Kuchen? Das ist für mich immer wichtig.
Isabel Scherle:
Ähm, es gab auf jeden Fall süße Stückchen und Obst, ja.
Moderator:
Ja, das ist ja alles perfekt. Wunderbar. Was würdest du jetzt anderen mit auf den Weg geben?
Isabel Scherle:
Ich glaube, ich würde anderen Betroffenen auch raten, sich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Ich denke, das ist ja auch bei anderen Krankheiten der Fall, weil mir das auch ein bisschen geholfen hat, mehr Verständnis für meine Situation zu bekommen. Ich glaube, das könnte hilfreich sein. Und eben auch der Austausch mit anderen Betroffenen – sich einfach generell darüber zu unterhalten, um zu schauen, was andere machen, was anderen hilft, was vielleicht auch mir helfen könnte. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man nie die Hoffnung verlieren sollte.
Moderator:
Du hast ja eben schon gesagt, dir geht es jetzt schon besser. Zwei Jahre immer wieder Schmerzen, am Anfang sogar dauerhaft. Wie geht's dir jetzt heute insgesamt – auch mit der ganzen Erfahrung drumherum?
Isabel Scherle:
Also, heute geht's mir auf jeden Fall besser, eben dadurch, dass die Schmerzen schon deutlich zurückgegangen sind. Ja, die ganze Situation – es war eine erlebnisreiche Zeit, die letzten knapp zwei Jahre für mich. Ich habe auch einiges gelernt und habe einfach für mich erkannt, dass ich mehr auf mich und meine Gesundheit, vor allem auf meine Hand, achten muss. Ich bin aber auch froh und dankbar, einfach an dem Punkt zu stehen, an dem ich jetzt heute bin, weil das war vor anderthalb Jahren oder so für mich noch nicht denkbar.
Moderator:
Schön, dass es wieder besser wird und vielleicht ganz in Ordnung kommt. Vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte, Isabel Scherle.
Isabel Scherle:
Ja, Dankeschön.
Moderator:
Wenn ihr mehr zur Schmerzbeurteilung wissen wollt, dann fragt einfach bei der Bezirksverwaltung nach, die euren Arbeitsunfall oder eure Berufskrankheit bearbeitet. Und wenn ihr von den Herzschlag-Folgen nicht genug bekommen könnt, dann schaut auf die BGW-Website:
www.bgw-online.de/podcast. Dort findet ihr alle Folgen zum Nachhören – das sind mittlerweile über 120. Die nächste Folge kommt wie immer in zwei Wochen. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann seid ihr automatisch mit dabei. Bis dahin und bleibt gesund.Jingle:
Herzschlag! Für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.
Interviewgäste
Dr. med. Mike Christian Zellnig MHBA
Chefarzt, Klinik für Schmerzmedizin
BG Klinikum Duisburg gGmbH
Samara Reiß
Reha-Managerin BGW
Bezirksverwaltung Karlsruhe
Claudia Pruß
Reha Managerin BGW
Bezirksverwaltung Berlin
Isabel
Teilnehmerin Schmerz-Seminar BGW
Für unseren BGW-Podcast "Herzschlag - Für ein gesundes Berufsleben" nutzen wir den Podcast-Hosting-Dienst Podigee des Anbieters Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Deutschland. Die Podcasts werden dabei von Podigee geladen oder über Podigee übertragen.
Wenn Sie unseren Podcast anhören, erfolgt eine Datenverarbeitung auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, d.h. Interesse an einer sicheren und effizienten Bereitstellung, Analyse sowie Optimierung unseres Podcastangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.
Podigee verarbeitet dann IP-Adressen und Geräteinformationen, um Podcast-Downloads/ Wiedergaben zu ermöglichen und statistische Daten, wie zum Beispiel Abrufzahlen zu ermitteln. Diese Daten werden vor der Speicherung in der Datenbank von Podigee anonymisiert oder pseudonymisiert, sofern Sie für die Bereitstellung der Podcasts nicht erforderlich sind.
Weitere Informationen und Widerspruchsmöglichkeiten finden sich in der Datenschutzerklärung von Podigee: podigee.com/de/about/privacy/.