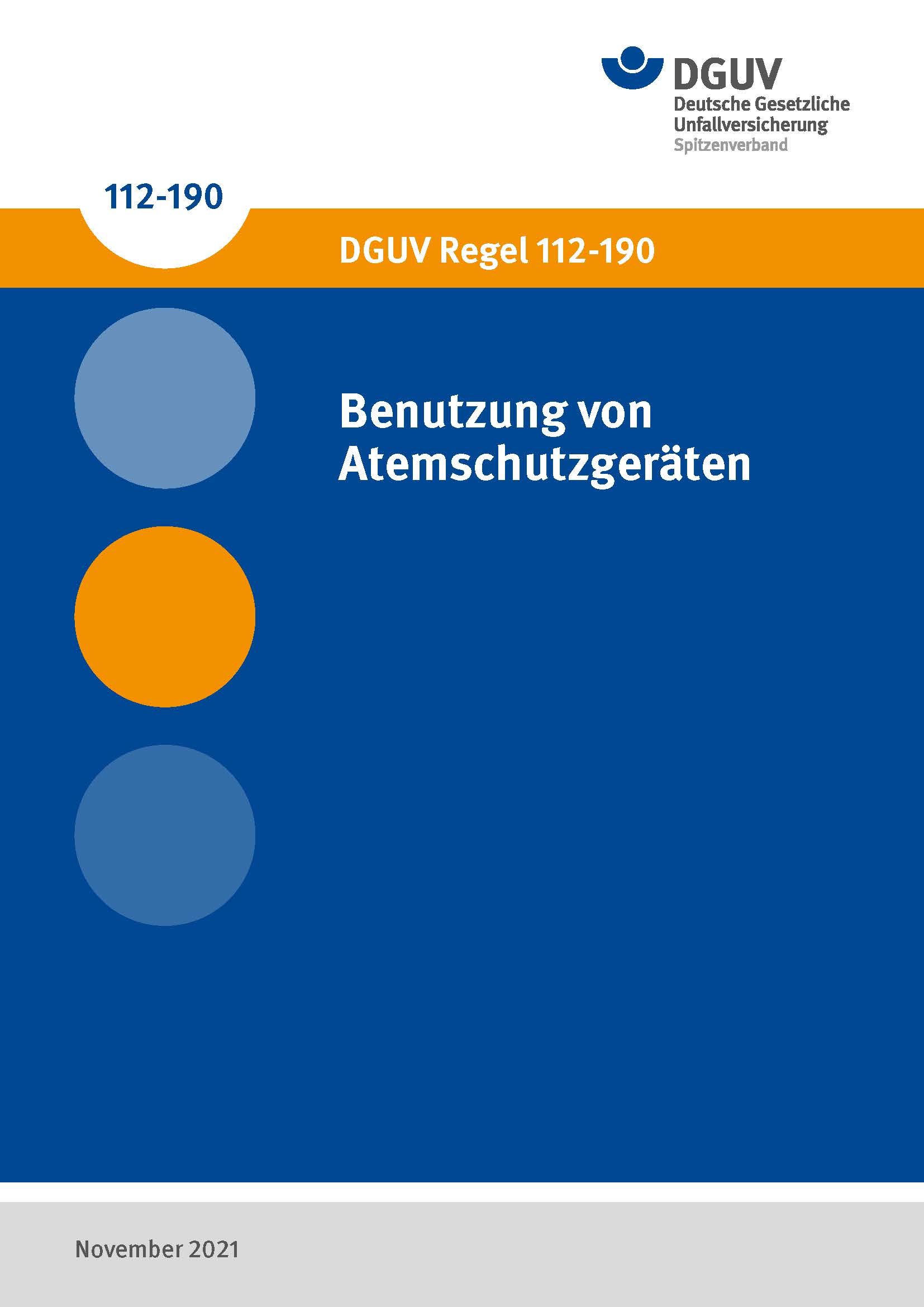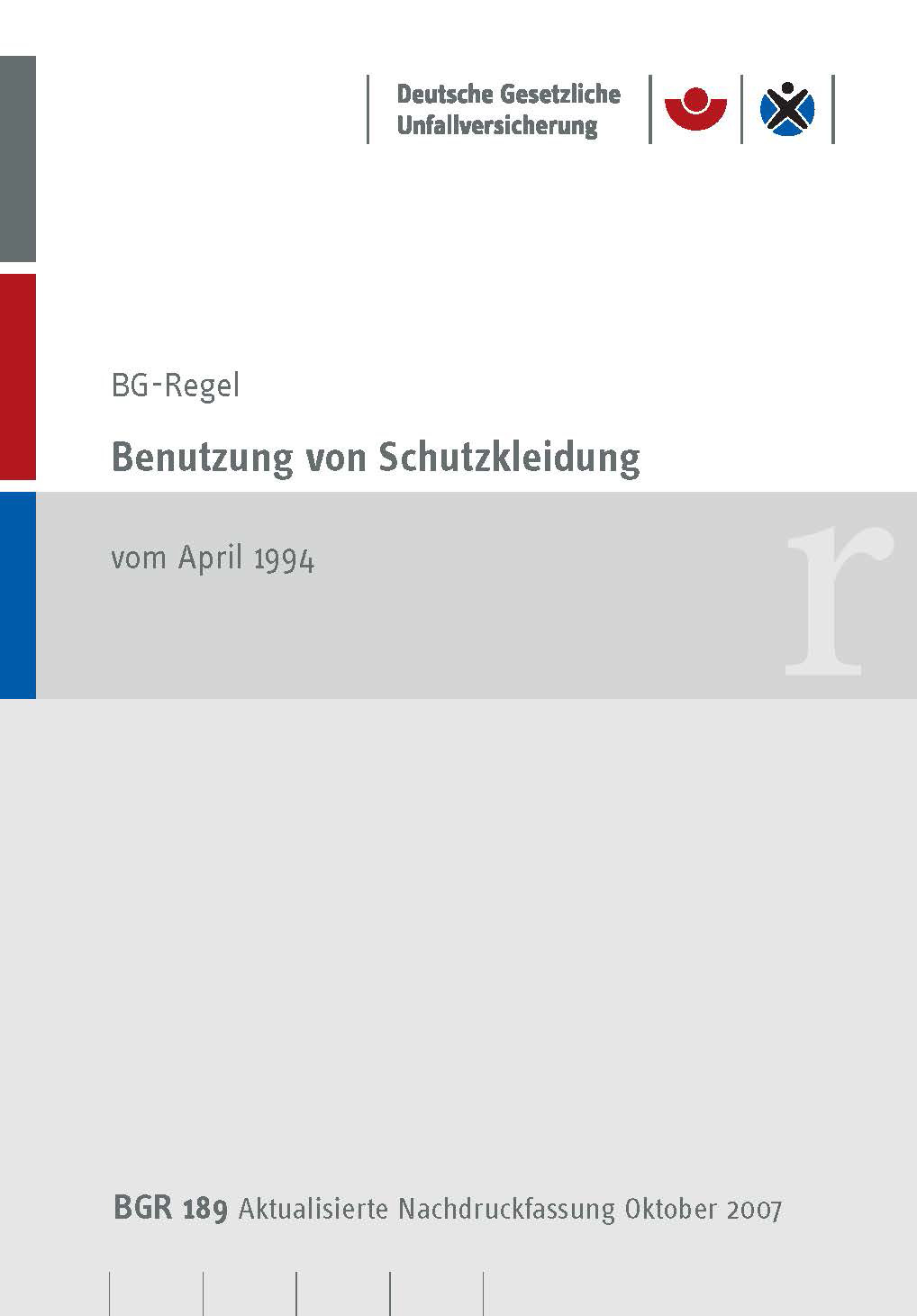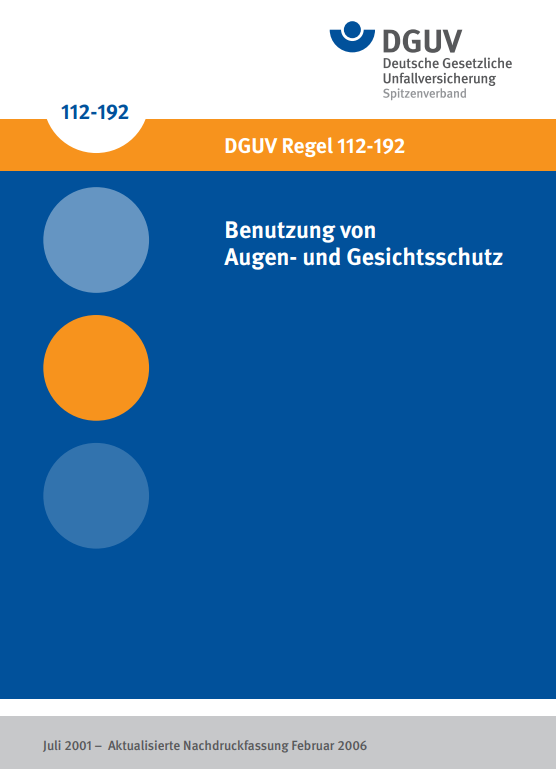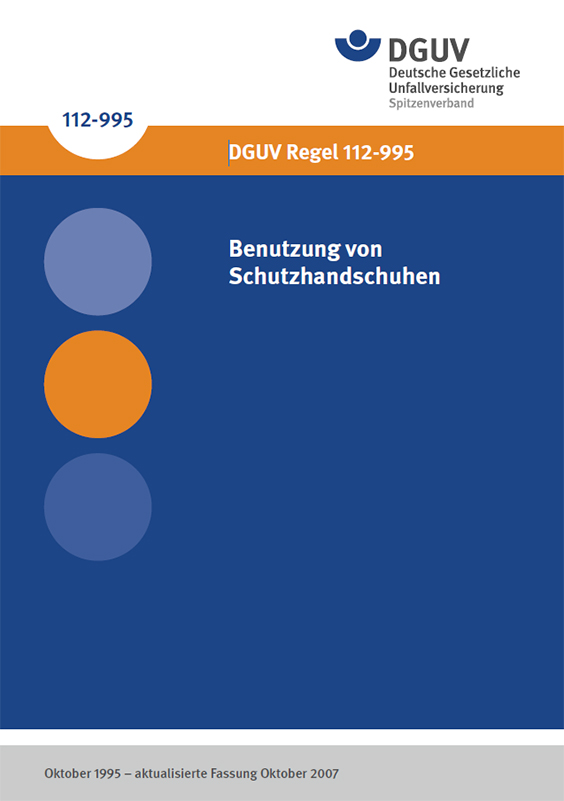Biologische Arbeitsstoffe und sensibilisierende Stoffe Risiken durch Biostoffe und sensibilisierende Stoffe werden vermieden
In der Schädlingsbekämpfung kommt man bei verschiedenen Tätigkeiten in Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Biostoffen. Umso wichtiger ist es, Erreger und Übertragungswege zu kennen sowie Schutzmaßnahmen zu treffen.
Unter dem Oberbegriff biologische Arbeitsstoffe - kurz Biostoffe - werden in der gleichnamigen Verordnung alle Mikroorganismen und Endoparasiten, die Infektionen oder sonstige gesundheitliche Beschwerden auslösen können, zusammengefasst. Dabei kann es sich um Bakterien, Viren, Pilze, aber auch um Zellkulturen und tierische Einzeller handeln. Keine Biostoffe im engeren Sinne, aber genauso zu behandeln, sind Ektoparasiten wie etwa Krätzmilben.
Zoonosen
Bei Erkrankungen, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden, spricht man von Zoonosen. Schädlinge können diverse Krankheitserreger übertragen. Beispiele sind Hantaviren im Urin von Nagetieren oder Ornithose-Erreger im Taubenkot. Einige der Zoonosen sind nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig.
Je nach Krankheitserreger sind die möglichen Infektionswege verschieden: Durch Einatmen von Aerosolen, Staub, über Mikroläsionen der Haut, Tröpfcheninfektion über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen, über Kontaktinfektion, wenn man mit verschmutzten Händen oder Handschuhen Keime auf Mund oder Augen überträgt oder beim Essen.
Allergien und Vergiftungen
Außer Infektionskrankheiten können Vergiftungen durch die Gifte von eingeatmeten Schimmelpilzsporen oder Allergien der Haut und Atemwege auftreten.
Neben den Biostoffen gibt es weitere organische Stoffe, die Probleme verursachen können, Pflanzen oder Pflanzenteile oder Tiere, die Allergien, Hautreizungen oder Vergiftungen verursachen können.
Zoonosen und Allergien
Gefährdende Tätigkeit | Erreger/Erkrankung | Vorkommen | Infektionsweg |
Kanalbeköderung | Hepatitis-A-Virus | Gewässer, Abwasser | Oral, Kontaktinfektion |
Kanalbeköderung, Nagerbekämpfung | Leptospira/Leptospirose, Weil’sche Krankheit | Nagetiere und deren Urin, Gewässer, Erdreich, Abwasser | Über Hautverletzungen, Kontaktinfektion über Schleimhäute von Mund und Augen |
Nagerbekämpfung | Hanta-Virus, Hämorrhagisches Fieber | Nagetiere und deren Kot und Urin | Einatmen von kontaminiertem Staub |
Nagerbekämpfung | Francisella tularensis/Tularämie, Nagerpest Borrelien/Borreliose, LCM-Viren/lymphozytäre Choriomeningitis | Nagetiere als Reservoirwirte oder direkte Überträger | Bisse, Stiche von Flöhen, Zecken, direkte Übertragung |
Taubenvergrämung und Taubenkotberäumung | Chlamydophila/ Papageienkrankheit, Ornithose | Tauben und deren Kot | Einatmen von kontaminiertem Staub |
Vogelzucht-, Mast-, Schlachtbetriebe desinfizieren | Chlamydophila psittaci (aviäre Stämme)/ Papageienkrankheit, Ornithose | Staub, Kot, erregerhaltige oder kontaminierte Gegenstände | Einatmen, Kontaktinfektion und orale Aufnahme |
Arbeit in oder in der Nähe von Unterschlupfen von Fledermäusen | Europäischer Fledermaus-Lyssavirus (EBLV 1 und 2) Tollwut (in Risikogebieten) | Fledermäuse | Bisse |
Bautenschutz, Bekämpfung von Vorratsschädlingen | Schimmelpilzgifte/ Vergiftungen und Allergien | Holz, Lebensmittel | Einatmen von Schimmelpilzsporen |
Arbeiten im Freien, Vogelberäumung | Sensibilisierende Stoffe/ Allergene: Eichenprozessionsspinner Taubenfedern Pollen Milben | Umwelt | Einatmen, Hautkontakt |
Arbeit im Freien | Frühsommer-Menigoenzephalitis FSME (in Endemiegebieten) Lyme-Borreliose | Zecken, vor allem in den niedrigen Vegetationsschichten | Zeckenbisse |
Diese Tabelle als PDF herunterladen
Beispiele für Maßnahmen zur Risikoreduzierung
- Verschleppung vermeiden: kontaminierte Arbeits- und Schutzkleidung sicher verpacken, Einweg-Schutzanzüge und FFP-Filter sicher entsorgen, Arbeitsgerät gründlich reinigen
- Kontaminierte Arbeitsgeräte und kontaminierte Schutzkleidung gesondert und verschlossen transportieren
- Kleidung und Arbeitsgeräte sachgemäß und möglichst bald nach der Benutzung reinigen
- Nach Kontakt zu potenziell infektiösem Material, zum Beispiel Nager- oder Taubenkot, Hände desinfizieren
- Essen, Trinken und Rauchen in kontaminierten Bereichen unterlassen
- Pausen einplanen und für geeignete Pausenbereiche oder Räume sorgen
- Vor dem Essen, Trinken und Rauchen die Hände desinfizieren oder reinigen
- Staubaufwirbelung vermeiden: Erregerhaltige Stäube befeuchten, zum Beispiel mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln
- In von Nager- oder Vogelkot belasteten Bereichen, bei hoher Staubentwicklung oder schlechter Belüftung geeigneten Atemschutz mit Partikelfilter verwenden
- Zur Taubenkotberäumung sowie zur Entfernung anderer organischer Stoffe mit gesundheitsschädlichen Eigenschaften geeignete Industriesauger mit Hepa-Filter verwenden und Atemschutz tragen
- Taubenkot als Sondermüll entsorgen
- Für die Entsorgung von biostoffhaltigem Müll reißfeste, geeignete Müllsäcke verwenden
- Bei starker Exposition, länger andauernden Arbeiten oder bei Spritzwasserbildung gebläseunterstützte Atemschutz-Vollmasken verwenden
- Art und Umfang der arbeitsmedizinischen Vorsorge ermitteln: Vorsorge anbieten oder Teilnahme an der Pflichtvorsorge sicherstellen